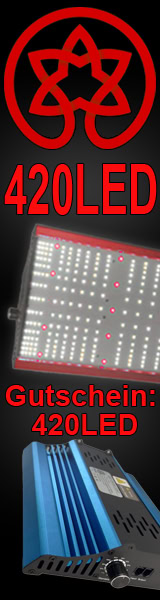Weil die Schweiz als einziges zentral europäisches Land kein Mitglied der EU ist, ticken dort die drogenpolitischen Uhren ein wenig anders als in den umliegenden Ländern. Vor 25 Jahren war die Diskrepanz noch größer.
Während man im benachbarten Baden-Württemberg gerade die Jagd auf Kiffer intensivierte, war Cannabis in der Schweiz fast schon legal. Damals hatten findige Cannabisliebhaber eine Lücke im Schweizer Betäubungsmittelgesetz erkannt und postwendend ausgenutzt. Diese Gesetzeslücke ermöglichte Hanfbegeisterten, Cannabis zum eigenen Bedarf oder auch im großen Stil anzubauen – und sogar zu verkaufen.
1999: Schweizer Drogenexperten empfehlen Legalisierung
Das Schweizer Betäubungsmittelgesetz (BetmG) unterschied Nutz- und Rauschhanf bis zu seiner Reform 2009 nicht anhand des THC-Gehalts, sondern die Anbau-Intention war ausschlaggebend für den rechtlichen Status von Blättern und Blüten. So entstanden Mitte der 1990er Jahre, zuerst in und um Zürich und später in der ganzen Schweiz, die heute legendären „Hanflädelis“. Dort gab es Schweizer Gras und Haschisch aus In- und Outdoorbeständen zu moderaten Preisen. Die Gesetzeslücke machte den Anbau von Cannabis für alle legal, lediglich die Weiterverarbeitung zur Droge sowie Verkauf und der Konsum der THC-haltigen Teile der Pflanze bedurften einer staatlichen Ausnahmegenehmigung.

Die war jedoch relativ einfach für die Herstellung von Duftstoffen oder auch zum Brauen von Hanfblüten-Bier zu bekommen. Die Kräuter wurden dann in Jutesäcke genäht und als Duftkissen zur Aromatherapie verkauft. Die Kunden wurden angehalten, die Säckchen nicht aufzureißen, sondern nur daran zu schnuppern. Somit war die Kette vom Samen bis zur fertigen Blüte komplett legal.
Auf Grundlage eines Berichts der staatlichen Drogenkommission EKDF, der 1999 die Legalisierung des Konsums, des Handels sowie des Anbaus von Cannabis empfohlen hatte, wollte der kleine Vielvölkerstaat als damaliges Nicht UN-Mitglied Cannabis um die Jahrtausendwende sogar komplett regulieren. Am 9. März 2001 verabschiedete der Bundesrat eine Empfehlung für die Revision des Betäubungsmittelgesetzes. Der Ständerat als eine der beiden gesetzgebenden Kammern stimmte mit großer Mehrheit für Empfehlung der Regierung. Die andere Kammer, der Nationalrat (Volkskammer) sollte später folgen.
2002/2003: UNO vs. Legalisierung
Aber ab 2002 wurde die Schweiz von der UNO unter Druck gesetzt. Falls man als letztes westliches Land Mitglied werden wolle, müsse sich auch die Schweiz an die „Single Convention“ von 1961 halten. Weil damals gerade über den Schweizer Aufnahmeantrag in die UN entschieden wurde, hatte man die Wahl zwischen legalem Cannabis oder der UNO-Vollmitgliedschaft. Auch die großen Nachbarn Frankreich und Deutschland begannen, immer lauter über den kleinen Cannabis-Grenzverkehr zu klagen.
Im September 2002 beugte man sich dem internationalen Druck und die Schweiz wurde UNO-Mitglied. Der Nationalrat lehnte das eigentlich schon sicher geglaubte Gesetz kurz darauf ab. 2004 verschwand das Thema dann komplett von der politischen Tagesordnung und es hagelte Kritik aus allen politischen Lagern. Nur Italien, Deutschland und Frankreich waren froh, als die Schweizer Polizei nach fast zehn Jahren der Duldung wieder Cannabis-Felder zerstörte. Die Hanflädelis und Cannabis-Felder verschwanden langsam, nur der Anbau für den eigenen Bedarf wurde weiterhin geduldet.
Volksinitiative scheitert 2008
Gleichzeitig formierte sich eine starke Bewegung, die 2008 einen bundesweiten Volksentscheid zur Legalisierung von Cannabis erzwang. Doch die finanziellen Mittel der „Eidgenössischen Volksinitiative für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz“ waren begrenzt und die Unterstützung in der Bevölkerung noch nicht groß genug. So wurde die Initiative im Dezember 2008 mit immerhin 36 Prozent Unterstützung abgelehnt. Nach der Niederlage war die Enttäuschung umso größer, als die Reform des Betäubungsmittelgesetzes zwei Jahre später den Anbau neu regelte und selbst die vielen, kleinen Selbstversorger auf einmal illegal waren.

Nach der Niederlage und der Reform des Betäubungsmittelgesetzes verharrten die Legalisierungs-Befürworter in einer Art Schockstarre – war man doch vom zweitliberalsten Land nach den Niederlanden ins hintere europäische Mittelfeld abgerutscht. Dort, wo einst riesige Felder blühten und jeder Growshop Stecklinge im Sortiment hatte, war jetzt selbst eine Pflanze Anlass für Polizeibesuch. Auch Samen sind seitdem komplett verboten. Der Konsum und Besitz von bis zu zehn Gramm Cannabis werden bei Erwachsenen allerdings nicht mehr strafrechtlich verfolgt, sondern stattdessen mit Bußen belegt. Die können, je nach Kanton und Zusatzgebühren, schon mal mehrere hundert Franken für das Rauchen eines Joints betragen.
Schweizer Nutzhanf ist in der EU eine Rauschdroge
Mit der Reform des BetmG wurde, ähnlich wie in der EU, der rechtliche Status am THC-Gehalt definiert. Aber anders als in der EU, wo ein Grenzwert von 0,3 % gilt, darf Nutzhanf in der Schweiz bis zu 1 % des Wirkstoffs enthalten. So konnte sich im vergangenen Jahrzehnt eine große Nutzhanf-Branche entwickeln, aus der auch viele CBD-Produzenten hervorgegangen sind. Denn auch in Sachen CBD ist man in der Schweiz weniger regulierungswütig. CBD-Blüten dürfen hier als Tabakersatz verkauft werden, Händler und Kunden haben 100 % Rechtssicherheit, solange der Hanf weniger als 1 % THC aufweist.
Allerdings machen legale CBD-Joints Schweizer Drogenfahndern seitdem Kopfzerbrechen. Denn ein CBD-Joint sieht aus und riecht wie ein echter. Nur erfahrene Cannabisliebhaber, von denen es bei der Schweizer Polizei nicht allzu viele gibt, wären überhaupt in der Lage, einen CBD-Joint von einem THC-haltigen zu unterscheiden.
2013: Neuer Wind aus den Großstädten
Doch weil Hanf und Cannabis in der Schweiz einen viel höheren Akzeptanzgrad als in der EU haben, regt sich seit einigen Jahren wieder starker Widerstand in der Zivilgesellschaft. So haben sich insgesamt sieben große Städte, darunter Genf, Bern, Zürich und Basel entschlossen, Cannabis-Modellprojekte zu beantragen. Federführend ist der Genfer Professor Cattacin, der die Diskussion mit seinem Vorschlag zu Cannabis Social Clubs schon 2013 angestoßen hatte. Das Städte-Projekt ist in drei Bereiche unterteilt: Die medizinische Abgabe, die Abgabe an Erwachsene sowie die Miteinbeziehung Jugendlicher mit bereits bestehendem, problematischem Konsummuster.
Die Idee dahinter ist, dass die Jugendlichen so, anstatt riskant zu kiffen, einen maßvollen und bewussten Umgang mit Cannabis erlernen können. Die Abgabe zum Freizeit-Konsum auf Bundesebene bleibt allerdings umstritten. Die derzeitige Bußgeldpolitik hat seit ihrer Einführung 2013 in einigen Kantonen zu einer wahren Anzeigenflut geführt, die Konsum nicht wie erhofft gesenkt und massive, juristische Probleme verursacht:

2016: Eine Gesetzeslücke macht Hoffnung
Im September 2016 wurde ein Jurastudent, der aufgrund des Besitzes von acht Gramm Cannabis eine Geldbuße entrichten sollte, vom Bezirksgericht Zürich freigesprochen. Der Angeklagte und dessen Rechtsbeistand, ebenfalls ein Jurastudent, waren wohl die ersten Schweizer, die genau in das revidierte Betäubungsmittelgesetz (BetmG) geschaut und entdeckt haben, dass nur der Konsum von Cannabis mit einem Bußgeld belegt werden darf. Doch ein Blick in den betreffenden Artikel 19 des BetmG bestätigt, dass der reine Besitz geringer Mengen Cannabisprodukte bis zu zehn Gramm zu Unrecht mit einer Geldbuße belegt wurde:
Nicht strafbar, keine Buße. Dieser Argumentation folgte der Zürcher Stadtrichter und sprach den Angeklagten frei, die acht Gramm seien laut BetmG nicht illegal, ein Konsumdelikt läge nicht vor. Laut dem Schweizer BetmG reicht nicht mal die Weitergabe einer geringen Menge zum Beispiel als Geschenk nicht aus, um ein Bußgeld zu verhängen, solange es nicht konsumiert wird.
Das sagt Peter Albrecht, emeritierter Strafrechtsprofessor und ehemaliger Präsident des Strafgerichts Basel-Stadt, zur „Schweiz am Sonntag“. Mittlerweile hat sich diese Rechtsinterpretation Schweiz weit durchgesetzt, der Besitz von bis zu zehn Gramm Cannabis oder Haschisch wird nicht bestraft.
2020/21: Verzögerung bei der medizinischen Anwendung
Obwohl beide Kammern des Parlaments in einer Erklärung bereits 2020 den Wunsch nach der Ausarbeitung einer gesetzlichen Grundlage zur Anwendung medizinischer Cannabisprodukte geäußert hatten, lässt die Umsetzung bis heute auf sich warten. Die zuständige Behörde Swissmedic schreibt dazu:
2021 scheint es, als könne Cannabis zum Freizeitkonsum von Schweizer Apotheken früher abgegeben werden als medizinische Cannabisblüten.

2022: Der Schweizer Weg heißt Modellprojekt
Nachdem nicht einmal der Besitz geringer Mengen bestraft werden konnte, haben sich beide Kammern des Parlaments um eine Lösung bemüht. Die ist seit Herbst 2020 nach mehreren, vergeblichen Anläufen Teil des Schweizer BetmGs und trägt den Namen Experimentierartikel. Dieser Zusatzartikel ermöglicht Apotheken die kontrollierte Abgabe von Cannabisprodukten an Erwachsene.
Konkret sollen die ersten vier Modellversuche ab 2022 in Zürich, Basel, Genf und Bern starten. Die Teilnehmenden müssen über 18 sein und über einen Wohnsitz in der teilnehmenden Gemeinde verfügen. Da die Modellprojekte keine Neueinsteiger anlocken wollen, müssen die Teilnehmenden bereits über Cannabis-Erfahrungen verfügen. Wer an der Studie teilnimmt, darf nicht mehr als den zuvor angegebenen Monatsvorrat einkaufen und erhält einen Ausweis, der zum Besitz des in der Apotheke erworbenen Cannabis berechtigt. Die jeweiligen Modellprojekte sind pro Stadt auf 5.000 TeilnehmerInnen beschränkt. Der Anbau soll in der Schweiz stattfinden, wobei Wirkstoffgehalt des Cannabis nicht über 20 % THC liegen wird. Der Preis soll sich am Schwarzmarkt (circa 10-20 SFr/Gramm) orientieren. Nach Ende der auf fünf Jahre angelegten Modellprojekte soll dann anhand der Ergebnisse entschieden werden, ob Cannabis in der Schweiz auf Bundesebene reguliert wird – oder nicht.
Dieser Plan ist besonders für Beobachter aus Deutschland interessant. Denn die Schweiz hat dem nördlichen Nachbarn schon häufiger als Wegbereiter für längst überfälligen Korrekturen der Drogenpolitik und/oder des Betäubungsmittelgesetzes (BtmG) gedient. Auch in Deutschland werden Modellprojekte immer wieder als erster Schritt zu einer umfassenden Regulierung genannt. Sollte die Schweiz diesen Weg erfolgreich beschreiten, steigen die Chancen für eine Regulierung auch in Deutschland immens.