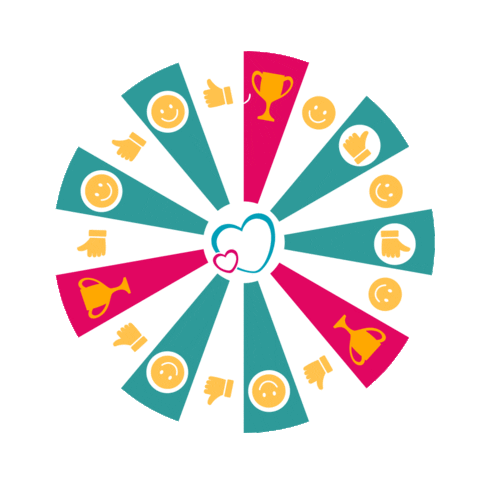Ist Cannabis doch kein „normales“ Medikament? Versuch einer Bestandsaufnahme.
Am 10.3.2017 ist das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften in Kraft getreten. Damit hat der Gesetzgeber Ärzten die Möglichkeit zur Verschreibung von Cannabis als Arzneimittel eingeräumt. Die Frage, die sich in der Folge stellte, ist: Welche Auswirkung hat die Einnahme von Medizinalcannabis auf die Fahreignung? Welche verkehrsrechtlichen Risiken treten in der Praxis für Patienten auf, die Medizinalcannabis zu sich nehmen? Um wie viele Cannabispatienten geht es überhaupt? Als mit der Materie befasster Anwalt will ich nach drei Jahren eine erste Zwischenbilanz ziehen.
Bis Mai 2017 verfügten nur 1061 Menschen in Deutschland über die Erlaubnis, medizinisches Cannabis (kontrolliert angebaut, entsprechend teuer und aus der Apotheke) erwerben zu können. Diese Zahl hat sich im Zuge der Gesetzesänderung vervielfacht. Da jedoch keine statistische Erfassung dieser Konsumenten, nennen wir sie Cannabispatienten, vorliegt, kann ihre Anzahl nur geschätzt werden. Die Schätzungen gehen von 50.000 Cannabispatienten in der Bundesrepublik aus, Tendenz steigend.
Welche Folgen hatte die Gesetzesänderung in verkehrsrechtlicher Hinsicht?
Die Gesetzesänderung hatte die gravierende verkehrsrechtliche Konsequenz, dass Cannabispatienten dem Medikamentenprivileg nach § 24 a StVG unterliegen, also keine Ordnungswidrigkeit mehr begehen, wenn beim Führen eines Kraftfahrzeuges mehr als 1 n/ml THC in ihrem Blut festgestellt wird. Die Bundesregierung wies in einer Antwort auf eine diesbezüglich gestellte „Kleine Anfrage“ der Linkspartei im Bundestag darauf hin, dass Cannabispatienten am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, sofern sie aufgrund der Medikation nicht in ihrer Fahrsicherheit eingeschränkt und in der Lage seien, das Fahrzeug „sicher zu führen“. Folglich ist die Teilnahme am Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss nicht mehr generell untersagt, solange keine fahrrelevanten Auswirkungen auftreten. Ist dies aber der Fall, so ist eine Strafbarkeit gemäß § 316 StGB/Trunkenheit im Straßenverkehr gegeben.
So weit, so gut. Allerdings gab es in den letzten Jahren immer wieder Fälle, in denen allgemeine Verkehrskontrollen dazu führten, dass auch Cannabispatienten trotz Vorlage des „Cannabispasses“ von Polizeibeamten zur Blutentnahme verbracht wurden. Obwohl eine Vielzahl der Ermittlungen eingestellt wurde, kam es in einigen Fällen zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens und dem Erlass eines Bußgeldbescheids. Diese Verfahren konnten angesichts der eindeutigen Rechtslage zwar für die Betroffenen erfolgreich beendet werden, allerdings währte die Freude darüber bei den Betroffenen oft nur kurz.
Die bei der rechtswidrigen Blutentnahme gewonnenen Erkenntnisse wurden von den Ermittlungsbehörden nämlich regelmäßig in der Folge an die zuständigen Führerscheinbehörden weitergeleitet. Diese Praxis soll nach Ansicht der Verwaltungsgerichte legal sein, da die Führerscheinstelle für die Abwehr von Gefahren zuständig sei, nicht dagegen für die Ahndung von Verstößen. Dabei solle die Führerscheinstelle auf alle vorhandenen Erkenntnisse zurückgreifen dürfen, egal, auf welche Art und Weise sie erlangt wurden.
Die Führerscheinstelle meldete sich also in der Folge bei den Betroffenen zur Klärung ihrer „Eignung“. Da die Anwendung der Fahrerlaubnisverordnung Ländersache ist, hat sich deutschlandweit noch keine einheitliche Rechtsanwendung eingespielt. Generell lässt sich festhalten, dass sich die Fahrerlaubnisbehörden mit der Anwendung des „neuen“ Rechts schwertun. Einheitlich ist zunächst der Ansatzpunkt der Behörden, nach dem Cannabis nur bei schweren Erkrankungen zur Anwendung kommen dürfe. Schwere Erkrankungen sind jedoch bei der Einschätzung der „Eignung“ zum Führen eines Fahrzeugs relevant. Daher fühlen sich die Führerscheinbehörden offenbar berufen, hier nachzuforschen. Zutage tritt hier der Generalverdacht, dass angesichts der veränderten Gesetzeslage cannabisaffine Personen versuchen, über den Weg der Verschreibung ihren illegalen Gebrauch zu legalisieren.
Einige Behörden verlangen zunächst vom Cannabispatienten, einen Fragenkatalog vom behandelnden Arzt beantworten zu lassen. Der Katalog behandelt im wesentlichen Fragen zum Vorliegen von Grunderkrankungen und ob etwaige Grunderkrankungen Auswirkungen auf die Fahreignung haben. Ferner wird eine Stellungnahme dazu verlangt, ob die Medikation eine Auswirkung auf die Fahreignung hat und sich der Patient verantwortungsbewusst im Umgang mit der Medikation (Compliance) verhält. Werden diese Fragen aus Sicht der Behörde in ausreichendem Umfang positiv beantwortet, kann der Cannabispatient aufatmen.
Andere Behörden fordern hingegen gleich ein kostenpflichtiges ärztliches Gutachten zur Beantwortung des obigen Fragenkatalogs von einer akkreditierten Drittstelle an. Dies zeugt von einem generellen Misstrauen dem behandelnden Arzt gegenüber und ist finanziell außerdem äußerst schmerzhaft, die Kosten für ein derartiges ärztliches Gutachten sind erheblich und übersteigen teilweise sogar diejenigen für eine medizinisch-psychologische Untersuchung (nachfolgend MPU). Zur Klarstellung: Diese Kosten trägt der Betroffene selbst, und zwar unabhängig vom Ergebnis.
Ganz forsche Fahrerlaubnisbehörden fordern gleich die Beibringung einer MPU. Auffällig ist, dass besagte Behörden oftmals noch die gleichen Fragestellungen nutzen wie bei den „normalen“ Cannabispatienten. Die Rechtswidrigkeit dieses Vorgehens ist offensichtlich, so mangelt es schon an der Verhältnismäßigkeit. Aber der Cannabispatient hat folgendes Problem: Verweigert er die MPU, darf die Fahrerlaubnisbehörde ihm den Führerschein entziehen. Die Entziehung wird für sofort vollziehbar erklärt. Nachfolgend obliegt es dem Patienten, die Rechtmäßigkeit der MPU-Anordnung gerichtlich prüfen zu lassen. Dafür muss er die Verwaltungsgerichte im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes bemühen. Die Verfahrensdauer ist in jedem Bundesland unterschiedlich und hängt von der finanziellen Ausstattung der Gerichte ab. Daher verzichten viele Betroffene auf eine kostspielige und langwierige gerichtliche Überprüfung und fügen sich in ihr Schicksal, weil die MPU sich unter diesen Umständen als das geringere Übel darstellen kann.

Dem Cannabispatienten schlägt also vielfach Misstrauen entgegen. Die Chancen, eine MPU oder die fachärztliche Begutachtung zu „bestehen“ sind zwar vorhanden, aber auch kein Selbstläufer. So wurde in gerichtlichen Entscheidungen etwa folgenden Punkten Beachtung geschenkt:
• Nur das auf Rezept in einer deutschen Apotheke erworbene Cannabis wird von Behörden und Gerichten als Medikament eingestuft. Teilweise wird von den Cannabispatienten die Vorlage der eingelösten Rezepte bei der Behörde verlangt. Kommt der Betroffene diesem Verlangen nicht nach, geht die Behörde von Missbrauch aus.
• Dies trifft diejenigen Konsumenten besonders hart, deren Krankenkassen die Übernahme der Kosten verweigern. Sie müssen das Cannabis auf teure Privatrezepte erwerben. Für einen Hartz-IV-Bezieher, der die hohen Preise für Medizinalcannabis nicht aufbringen kann, wird dadurch indirekt vom Hartz-IV-Status auf die missbräuchliche Verwendung von Drogen geschlossen.
• Wird bei einer Kontrolle neben Cannabis auch Alkohol nachgewiesen, besteht nach neuer Rechtsprechung ebenfalls keine Fahreignung, weil dies den Schluss zulassen soll, dass das medizinische Cannabis nicht entsprechend der ärztlichen Verordnung eingenommen wurde.
• Eine missbräuchliche Anwendung soll nicht nur bei einer zu hohen Dosierung vorliegen, sondern auch bei einer verordnungswidrigen Einnahme, also mittels eines Joints statt eines Vaporizers.
• Herangezogen werden sämtliche vom Betroffenen preisgegebenen Informationen, sowohl gegenüber den Polizeibeamten als auch aus sozialgerichtlichen Verfahren im Streit um die Übernahme der Behandlungskosten durch die Krankenkassen.
Wir können zusammenfassen, dass auch Medizinalcannabis im Straßenverkehr nicht mit anderen Medikamenten gleichgestellt wird, sondern die Konsumenten aufgrund der gegen Cannabis gehegten Vorurteile oftmals einer Sonderbehandlung und damit einhergehenden finanziellen Belastungen unterliegen. Stellt man zudem die Gleichung auf, dass Krankheit auch in Deutschland oftmals zu Armut führt, bedeutet die Praxis für viele Cannabispatienten früher oder später das Führerschein Aus. Von Hartz-IV lassen sich weder ein fachärztliches Gutachten noch eine MPU finanzieren, also verlieren die Betroffenen am Ende doch ihren Führerschein.
Hiergegen müssen wir weiter gerichtlich vorgehen und hoffen, dass die Forschung in Ländern, die Cannabis bereits legalisiert haben, uns hierbei durch wissenschaftliche Studien unterstützt.