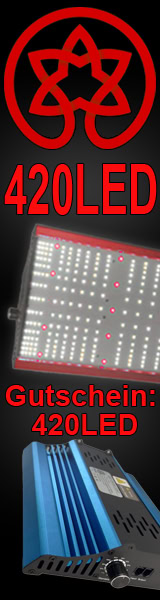Du willst diesen Beitrag hören statt lesen?
Klicke dazu auf den unteren Button, um den Inhalt von Soundcloud zu laden.
Obwohl Cannabis nach wie vor die am meisten verbreitete illegale Substanz ist, wird riskanter Cannabiskonsum häufig ignoriert und tabuisiert.
Die geltende Verbotspolitik hat bisher weder für die Verbesserung der Gesundheit gesorgt, noch wird Prävention strukturell genug gefördert. Vielmehr liegt Suchtprävention hauptsächlich in der Verantwortung von Eltern, Schulen und sozialen Einrichtungen. Der Bedarf an modernen Präventionsangeboten und Maßnahmen zur Qualitätssicherung ist jedoch groß. Außerdem braucht es ein koordiniertes und abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten im Hilfesystem.
Obwohl Cannabis nach wie vor die am meisten verbreitete illegale Substanz ist, wird riskanter Cannabiskonsum häufig ignoriert und tabuisiert. Während Berliner Jugendliche immer weniger Tabak rauchen, haben 69 Prozent der Berliner*innen zwischen 16 und 27 Jahren schon einmal im Leben gekifft. Die Zahl der regelmäßig Cannabis Konsumierenden hält sich zudem auf konstantem Niveau. Dies hat eine Befragung der Fachstelle für Suchtprävention von 2014 ergeben. Aktuell führt die Fachstelle für Suchtprävention wieder eine Befragung unter Berliner SchülerInnen zu ihrem Cannabiskonsum durch.
Die Erfahrung aus den Präventionsseminaren an Schulen mit dem Schwerpunkt Cannabis zeigt, die Gründe sind vielfältig, warum junge Menschen Cannabis rauchen. Etwa 3.200 Schüler*innen in Berlin wurden bisher durch Angebote der Fachstelle für Suchtprävention erreicht und sprachen über ihre Motivation und ihre Einstellung zum Cannabiskonsum. Demnach versuchen viele Jugendliche sich mit einem Joint zu entspannen oder dem Leistungsdruck und den Ansprüchen ihrer Eltern zu entfliehen. Andere kiffen, um dazuzugehören. Teenager denken oftmals, es sei auch für sie völlig risikolos, Cannabis zu konsumieren.
In Workshops mit geflüchteten Jugendlichen spielen illegale Substanzen ebenfalls eine Rolle. Bei ihnen stößt, auch durch kulturelle und religiöse Erfahrungen bedingt, der aus ihrer Sicht widersprüchliche Umgang mit Cannabis und Alkohol in Deutschland auf Verwunderung. Gerade in Berlin ankommende unbegleitete minderjährige Geflüchtete gehören zu einer Risikogruppe. Sie bringen in der Regel schwierige Lebensumstände mit, wie die Trennung von ihren Familien, traumatische Erlebnisse im Heimatland oder während der Flucht sowie eine Perspektivlosigkeit für die Zukunft. Aufgrund dieser Erfahrungen versuchen sie häufig Cannabis, als Bewältigungsstrategie zu nutzen. Das führt jedoch eher zu einer Verstärkung der Probleme, z. B. dem Fehlen in der Schule.
Cannabispolitik darf die Präventionsarbeit nicht behindern
Viele Eltern scheuen sich, es offen anzusprechen, wenn ihre Kinder Cannabis konsumieren. Sie sorgen sich, dass ihnen Konsequenzen für die Ausbildung oder den Führerschein drohen. An Schulen besteht oftmals die Besorgnis, mit dem Etikett „Problemschule“ versehen zu werden. Daher wird zu selten von Cannabiskonsum der Schüler*innen gesprochen oder Präventions- und Beratungsstellen zur Unterstützung aufgesucht.
Das verwundert nicht, schaut man sich die aktuellen bundesweiten Drogenkriminalitätsstatistiken an. Demnach machen Straftaten wegen Cannabiskonsum 65 Prozent der konsumnahen Delikte aus (BKA, 2017). Die Zahl der Vergehen wegen Cannabiskonsum bei Jugendlichen ist im Vergleich zum Vorjahr um 16,3 Prozent gestiegen, während die Straftaten wegen des Handels und der Verbreitung von Cannabis rückläufig sind. Hier entsteht der Eindruck, dass besonders Konsumierende kriminalisiert werden – obwohl der Konsum von Cannabis nach dem deutschen Betäubungsmittelrecht straffrei ist.
Die Stigmatisierung, die durch Cannabis erfolgen kann, hat zudem eine starke Wirkungskraft auf junge Menschen mit problematischem Konsum. Sie finden häufig erst sehr spät, manchmal zu spät, einen Zugang zu frühzeitiger Unterstützung des Hilfesystems. Es vergehen im Schnitt acht Jahre riskanten Konsumierens, bis sie ambulante oder stationäre Behandlung nutzen. Eine Abkehr von Verboten in der Cannabispolitik hin zu einem offeneren Umgang mit dem Thema birgt viele Chancen. Jugendlichen und ihren Eltern könnte der Zugang zum Hilfesystem erleichtert und so die Zahl der riskant Konsumierenden verringert werden.
Die Verbesserung des Jugendschutzes in den Mittelpunkt stellen
Besonders das frühe Einstiegsalter bei Jugendlichen bedeutet ein erhöhtes gesundheitliches Risiko. Im Schnitt konsumieren die 18 – 20-Jährigen mit 16,4 Jahren erstmals Cannabis. Da sich ihr Gehirn noch entwickelt, sind Jugendliche besonders gefährdet. Je jünger das Einstiegsalter ist, desto höher ist das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Daher: sollte die Berliner Regierung die regulierte Abgabe von Cannabis umsetzen, braucht es einen am Jugendschutz orientierten Umgang mit Cannabis. Das bedeutet, weiterhin keine Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren!
Gleichzeitig zeigt sich, dass das geltende Verbot nicht dazu geführt hat, dass Jugendliche, die trotzdem Cannabis zu sich nehmen, kritisch hinterfragen, warum sie konsumieren. Auch stellen sie ihre teils problematischen Konsumgründe nicht infrage. Daher sollten Präventionsmaßnahmen und die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit dem Thema unter den Bedingungen einer regulierten Abgabe verstärkt und strukturell verankert werden. Die Fachstelle für Suchtprävention spricht sich deshalb z. B. dafür aus, dass Suchtprävention in die Lehrpläne aufgenommen wird.
Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist die Schule, die Lebenswelt, die bisher am besten erforscht ist und hervorragende Möglichkeiten zur Verankerung von wirksamen suchtpräventiven Angeboten bietet (2013, Expertise zur Suchtprävention). Um das zu erreichen, müssen allerdings alle beteiligten Akteure zusammenwirken – Suchtprävention und Suchthilfe sowie Schulen, Jugendämter, Erziehungs- und Familienberatungsstellen.
Auch müssen sowohl Jugendliche als auch ihre Eltern einbezogen werden. Interaktive Angebote erreichen junge Menschen besonders gut, da reine Informationsvermittlung und Aufklärung keine oder sogar negative präventive Effekte haben können. Ein moderner Ansatz in der heutigen Suchtprävention ist der Risikokompetenzansatz. Die Fachstelle für Suchtprävention arbeitet daher in vielen Präventionsprojekten mit dem RisflectingKonzept, welches Risikokompetenzförderung als Ziel zur Verbesserung der Gesundheit versteht.
Gerade Jugendliche müssen sensibilisiert und gut über die Risiken des Cannabiskonsums informiert werden – dabei gilt: weder dramatisieren noch verharmlosen, damit sie sich ernst genommen fühlen. So können sie über ihren eigenen Konsum reflektieren und anhand wissenschaftlich fundierter Methoden erlernen, eigenes Risikobewusstsein und Konsumkompetenz zu entwickeln. Dies ist wesentlich für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer zunehmend leistungsorientierten Gesellschaft, in der Cannabis – trotz Verbot – heute sehr verbreitet ist. Sie müssen sich über eigene Stärken bewusst sein und Strategien entwickeln können, um mit Stress, Belastung und anderen Risikofaktoren kompetent umzugehen.
Eine vertrauensvolle Atmosphäre und jugendgerechte Methoden im Präventionsseminar führen in der Regel dazu, dass sich die Schüler*innen öffnen und auch von unschönen Rauscherlebnissen berichten. Immer wieder „kennt jemand jemanden, der jemanden kennt“, der eine cannabisinduzierte Psychose entwickelt hat. Diese Berichte ermöglichen einen kritischen Blick auf den Cannabiskonsum und die eigenen Verhaltensweisen.
Erfreulicherweise lässt sich in Berlin die Tendenz beobachten, dass Schulen immer häufiger die Suchtpräventionsangebote annehmen bzw. aktiv anfragen. Schulen, die nicht die Augen vor Substanzkonsum verschließen, sondern sich aktiv und fundiert mit Regeln und Handlungsempfehlungen auseinandersetzen, können positive Erfahrungen aus den Präventionsseminaren auch an andere Schulen weitergeben.
Bis sich jedoch alle Verantwortlichen dem Thema tatkräftig angenommen haben, wird es noch ein langer Weg sein. Die Zeiten des Wandels im politischen Denken und Handeln bieten eine wichtige Chance, um die Stärkung der Suchtprävention zu gestalten und entscheidend voranzubringen. Sucht beginnt im Alltag und auch die Prävention muss die Menschen dort erreichen und in den entsprechenden Strukturen des täglichen Lebens verankert werden. Nur so kann Prävention nachhaltig wirksam sein und die Gesundheit jedes einzelnen Menschen und der Gesellschaft verbessern!