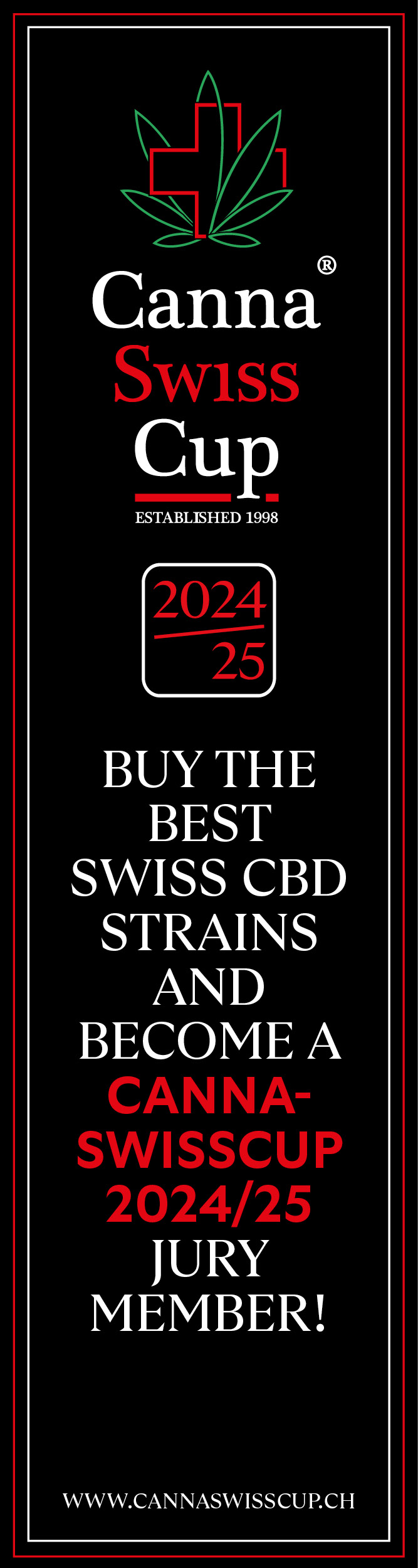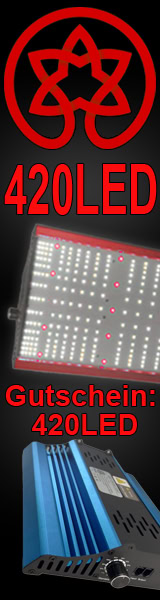Krankenkassen müssen eine Behandlung mit Cannabis zuerst genehmigen, bevor die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten erstatten kann. Das geht aus einem Bericht der Bundesregierung nach einer Anfrage der Partei Die Linke hervor. Zudem befürchtet diese, dass Patienten auch aufgrund der Preisentwicklung des Medikaments in den Apotheken eine finanzielle Verschlechterung seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes hinnehmen müssen.
Seit der Gesetzesänderung vom 10. März 2017 liegt die Verantwortung für eine Therapie mit Cannabis nicht mehr beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das hat zur Folge, dass Patienten sich von der Behörde keine Sondergenehmigung mehr ausschreiben lassen müssen, um an ihre Medizin zu kommen, da die Verantwortung jetzt in den Händen der Ärzte liegt. Cannabis ist damit also ein verschreibungsfähiges Medikament geworden. Die Krankenkassen können jedoch eine Kostenerstattung verhindern, sofern sie eine Therapie mit Cannabis nicht für sinnvoll halten und dies begründen können, wie aus dem Schreiben der Regierung hervorgeht.
Die Linke berichtet in der Anfrage von einem Fall, in dem die Kostenübernahme für einen Patienten mit einer Ausnahmegenehmigung durch die Krankenkasse nicht gestattet wurde. Begründet habe diese das damit, dass eine „Behandlung mit Dronabinol keine Aussicht auf Erfolg habe und nicht alle Therapiealternativen ausgeschöpft seien“. Die Partei fürchtet nun, dass Patienten mit einer Besitzerlaubnis für Cannabis durch diese Entscheidung zukünftig Nachteile in der medizinischen Versorgung haben könnten.

Was sagt die Regierung?
Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort mit dem Titel Preisentwicklung und ärztliche Betreuung bei Cannabismedizin zunächst darauf hin, dass Cannabisarzneimittel vom Arzt nur verschrieben werden dürfen, wenn dieser „aufgrund eigener Prüfung zu der Überzeugung gelangt, dass nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaft die Anwendung zulässig und geboten ist.“
Ist der Arzt der Meinung, Cannabis könnte bei der Heilung helfen, und sollte diese Leistung vom Patienten schließlich in Anspruch genommen werden, könne diese von der gesetzlichen Krankenversicherung nur erstattet werden, wenn die Krankenkasse für die Therapie eine Genehmigung erteilt. Damit werde „dem Ausnahmecharakter, der mit dem Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften neu eingeführten Regelung Rechnung getragen“, erklärt die Bundesregierung weiter. Damit zielt sie darauf ab, dass es für Patienten die Möglichkeit einer Erstattung für eine Cannabis-Therapie gibt, „obwohl für sie kein genügend hohes Evidenzlevel vorliegt“, was eigentlich eine Voraussetzung für eine Kostenübernahme der gesetzlichen Krankenversicherung sei.
Empfehlungen für Betroffene, deren Anträge trotz ärztlicher Gutachten abgelehnt wurden, hat die Bundesregierung nicht, bewerten möchte sie es auch nicht. Stattdessen verweist sie darauf, dass es für die Patienten durch eine Übergangslösung für drei Monate möglich sei, ihre Medizin weiterhin aus Apotheken zu beziehen, auch wenn eine Kostenübernahme auf Grundlage des neuen Gesetzes nicht erfolgen könne.
Zudem sei es nicht ihre Aufgabe, „die fachliche Bewertung einzelner Krankenkassen zu überprüfen und durch eigene Bewertungen zu ersetzen“, sie beobachte lediglich die Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen. Dabei geht die Regierung weiter von der Richtigkeit einer früher getroffenen Aussage aus, „dass die gesetzlichen Krankenkassen ihre gesetzlichen Leistungsverpflichtungen erfüllen werden.“
„Die Linke“ bemängelt Preisentwicklung
In ihrer Anfrage macht Die Linke zudem auf die Preisentwicklung in den Apotheken nach der Gesetzesänderung aufmerksam. Seitdem Inkrafttreten wird Cannabis als Rezepturarzneimittel behandelt, das bedeutet, sie werden vor dem Abpacken beispielsweise durch Zerkleinern der Blüten verarbeitet, anstatt diese in unverändertem Zustand als Fertigarzneimittel an den Patienten auszuliefern. Das würde Auswirkungen auf den Preis haben, bemängelt Die Linke. Der Partei liegen Informationen vor, in denen Patienten von einer Steigerung von bis zu 100 Prozent berichten würden.
Die Regierung erklärt dazu, dass sich der Preis nach der Arzneimittelpreisverordnung richte. Sie könne aber keine Angaben darüber machen, wie hoch der durchschnittliche Abgabepreis der Apotheken vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes war. Zahlen würden der Bundesregierung seit dem 10. März 2017 nicht vorliegen, dafür bezifferte sie aber die Preise vor der Änderung des Gesetztes. Da hätten die monatlichen Kosten durchschnittlich bei 540 Euro pro Patient und der Abgabepreis im Mittel bei 18 Euro pro Gramm gelegen.
Die Bundesregierung erklärt weiter, dass sich der rechtliche Rahmen der Preisbildung mit dem neuen Gesetz nicht geändert habe und sich weiter nach der Arzneimittelverordnung richte. Auch gebe es keine Vorgaben zur Abgabeform. „Je nach arzneimittelrechtlicher Einstufung und Verfügbarkeit sind die am Markt angebotenen unterschiedlichen Cannabis-Produkte als zugelassene Fertigarzneimittel, einzelimportierte Fertigarzneimittel, Rezepturarzneimittel oder z. B. als unverändert aus größeren Gebinden umgefüllte Blüten zu erhalten“, schreibt die Regierung dazu. Ob ein Arzneimittel als Rezepturarzneimittel eingestuft werde, würde von der Apothekenbetriebsordnung abhängen.