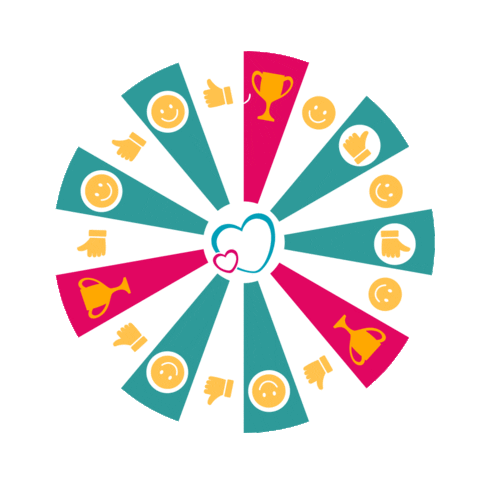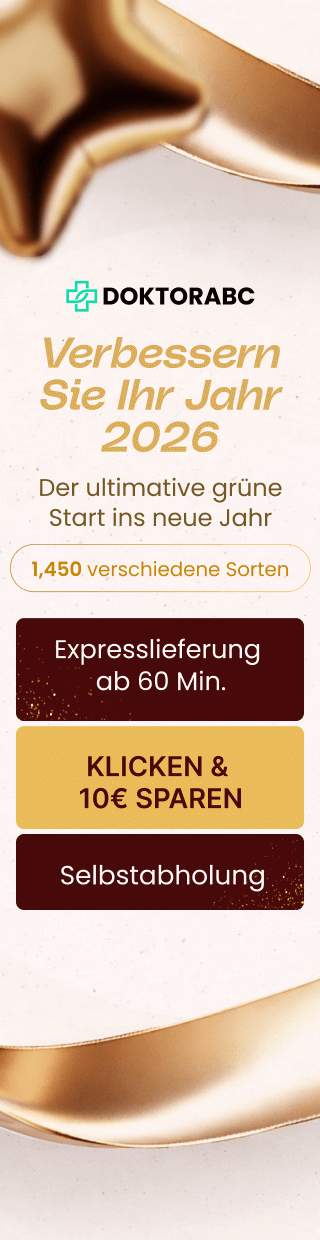Sophie ist vor 23 Jahren in Ulm geboren, als augenscheinlich glückliches und gesundes Kind mit zehn Fingerchen und zehn Zehen. Dennoch hatte sie seit ihrer frühen Kindheit immer wieder Probleme mit Kopfschmerzen, Erschöpfung, Übelkeit und Depressionen. Ja, Depressionen – ja, als Kind. Doch so traurig es ist, sich ein Kind mit Depressionen vorzustellen, dies war alles erst der Anfang.
Diagnosenmarathon
Zwischen 10 und 12 Jahren, die Pubertät und die damit einhergehende Umstellung der Hormone taten ihres dazu, potenzierten sich Sophies Probleme. Depressionen, Kopfschmerzen und Erschöpfung verstärkten sich und eine Schlafstörung kam hinzu. Diese Schlafstörung wirkte sich selbstredend zusätzlich negativ auf die Erschöpfung aus, und zwar so sehr, dass Sophie sich nun nach dem Aufstehen und vor der Schule vor Erschöpfung erbrach. So konnte es nicht weitergehen. Sophie litt und war kaum fähig, die Schule zu besuchen. Ihre Eltern waren verzweifelt. So begann der Ärztemarathon.
Man suchte nach der Wurzel des Übels und fand Hashimoto. Hashimoto ist eine Schilddrüsenerkrankung, bei der sich die Schilddrüse zersetzt und nach und nach keine mehr Hormone produziert. Ist die Krankheit allerdings diagnostiziert, kann man die Patienten gut auf Ersatzpräparate einstellen. Ist dies geschehen, es muss engmaschig kontrolliert und regelmäßig neu eingestellt werden, lebt man mit Hashimoto nahezu symptomfrei und ebenso lange wie ein Durchschnittsmensch. Bei ihrer Diagnose war sie 12 und es wurde zusätzlich ein starker Vitamin D Mangel festgestellt. Ihr wurde versprochen, dass, wenn ihr Hashimoto behandelt und ihr Vitaminmangel behoben ist, sie ein ganz normales Leben leben wird. Zum ersten Mal. Doch weit gefehlt, es ging ihr nicht besser und die Besuche bei weiteren Ärzten brachten weitere Diagnosen, aber keine Lösung.
Es wurden ihr Depressionen und Diabetes Typ 1 diagnostiziert, was ein weiterer Lichtblick war. Ging doch auch ein Diabetes mit furchtbarer Erschöpfung einher. Doch auch dieser Pfad führte wieder ins Nichts. Sie wurde auf Insulin eingestellt und ihre Symptome blieben unverändert. Inzwischen hatten sich zu ihren Symptomen starke chronische Schmerzen gesellt. Sie war 18 und wollte endlich eine Diagnose, um ein lebenswertes Leben führen zu können. Sie hatte keine Freunde, weil sie nach der Schule einfach zu fertig war, um etwas zu unternehmen. Ähnlich verhielt es sich mit Hobbys, Reisen, Zukunftsplänen. Selbst das Lernen blieb auf der Strecke. Sophie war kaum fähig, ihr eigenes Leben zu meistern. Sie nahm es noch einmal mit voller Kraft in Angriff, ihre Diagnose und damit ihr Leben zu erkämpfen.
Der Kampf um Autonomie und Akzeptanz
Auch Sophie ist, wie wohl die meisten von uns, in Richtung Pubertät mit Cannabis in Berührung gekommen. Ausschließlich im sozialen Kontext, sagt sie und fügt hinzu, dass sie Cannabis zu der Zeit nicht als Medikament oder irgendetwas das helfen konnte ansah. Allerdings merkte sie damals schon, dass es ihr gegen ihre Übelkeit half, dachte sich aber nicht viel dabei. Ihre Eltern waren wie viele Eltern gegen den Konsum. War ihre Tochter doch schon krank genug. So entschloss sie sich, stationär in eine psychiatrische Klinik nach Freiburg zu gehen, um sich durchchecken zu lassen. Sie war ehrlich zu den Ärzten, denn inzwischen hatte sie entdeckt, dass ihr Cannabis, wenn sie es nicht mit Tabak mischte, sehr gut gegen einige ihrer Symptome half. Sie rauchte nun mit Unterstützung ihrer Freunde täglich. Ohne ihre Freunde hätte Sophie sich die Menge, die sie täglich benötigt, niemals leisten können.
Vor allem Übelkeit und Schlaf hatten sich signifikant verbessert und dies teilte sie den Ärzten der Klinik mit, woraufhin sie den Eintrag “Cannabis Abusus” erhielt. Für sie war es ein Schlag ins Gesicht, war es doch das Einzige, was ihr je geholfen hatte. Vorher hatten die Ärzte versucht, ihre wirklich starken Schmerzen mit Ibuprofen zu therapieren, doch nichts half. Zusätzlich diagnostizierten sie in der Klinik eine Anpassungsstörung, was quasi die Akutform einer PTBS ist. Auch dies war ein Schlag, hatte Sophie ihre Probleme doch schon beinahe seit der Geburt. Sie sagte, dass sie glaubt, dass sie in der Klinik nicht wirklich ernst genommen wurde.
Wenn sie klinisch nichts finden, kann ich nichts haben, haben die sicher gedacht
Sophie
“Im Blut haben sie nichts gefunden und im CT auch nicht. Wenn sie klinisch nichts finden, kann ich nichts haben, haben die sicher gedacht”, erklärt Sophie und klingt dabei nicht einmal sauer. Generell hat man das Gefühl, dass sie dieses ganze Drama einfach mit Fassung trägt und nicht aufgibt – man hat allerdings auch das Gefühl, einem sehr reifen Menschen zu begegnen, was ganz bestimmt mit ihrem frühen Leid zu tun hat. Der Klinikaufenthalt brachte sie also nicht weiter. Es folgten abermals unzählige Ärzte und neue Diagnosen, wie zum Beispiel chronische Migräne, welche nun endlich einige ihrer Schmerzen erklärte und Angststörung/Panikattacken (als logische Konsequenz). Sie hatte irgendwann den Gedanken: “Was, wenn ich keine Lösung finde? Was, wenn ich Erwerbsminderungsrente beantragen muss, aber noch nie einen Erwerb hatte? Was, wenn ich niemals arbeiten oder eine Ausbildung machen kann? Diese Reise nahm kein Ende, bis sie mit 19 Jahren auf das Fibromyalgiezentrum in München aufmerksam wurde und eine Diagnose bekam. DIE Diagnose.

Ein neuer Kampf beginnt
Leider ist Fibromyalgie eine äußerst schlecht erforschte Krankheit, die man jahrelang für eine psychosomatische Erkrankung hielt und zum Teil bis heute so behandelt. Die Leitlinie sieht heute eine Bewegungstherapie kombiniert mit Antidepressiva und/oder Antipsychotika vor. Allerdings hatte Sophie ja gute Erfahrungen mit purem Cannabis gemacht und herausgefunden, dass es zu medizinischen Zwecken im selben Jahr legalisiert wurde. Da Sophie ein sehr interessierter, neugieriger, intelligenter Mensch ist, recherchierte sie in jeder Minute, die ihr ihre Krankheit nicht nahm und fand heraus, dass sie austherapiert sein musste. Sie wusste, sie würde jedes der unwirksamen und nebenwirkungsstarken Medikamente nehmen müssen, die die Leitlinie vorsah. Sie stellte sich darauf ein, dass es scheiße werden würde, sagt sie, aber wie scheiße es werden würde, damit hatte nicht einmal sie gerechnet.
Es war ein Münchner Neurologe, welcher sie ihrem Ziel, sich mit Cannabis zu therapieren, einen Schritt näherbringen sollte. Sie erzählte mir, dass sie das Gefühl hatte, auch dieser Arzt sei nicht wirklich interessiert an ihrem Fall. Sie hatte ihm beispielsweise erzählt, dass sie in ihrer Jugend schon Antidepressiva ausprobiert hatte, diese aber absetzen musste, da Wechselwirkungen mit ihrem Insulinpräparat auftraten. Dennoch verschrieb er ihr ein Leitlinienpräparat nach dem anderen. Duloxetin, Pegabalin und Amitryptillin waren nur der Anfang. Er hatte sie nicht ausreichend aufgeklärt, denn was auf sie zukam, waren die brutalsten Nebenwirkungen, von denen ich persönlich je gehört hab. Sophie hatte vorher schon ein schweres Leben, in dem wenig möglich war, doch nun war sie 2 Monate am Stück bettlägerig. Ihr war schwindelig und übel und nichts ging mehr. Sie war verzweifelt, denn sie wollte ankommen. Ankommen in einem Leben, in irgendeinem Hauptsache wert es zu leben.
Immer wieder hatten ihr die Ärzte versprochen, alles würde gut. Immer wieder gab es neue Medikamente gegen neue Diagnosen und nichts wurde besser, und nun schien es, als würde sie gar nicht mehr auf die Beine kommen. Das Gegenteil aller Versprechungen war der Fall. Durch ihre lange Bettlägerigkeit wurden ihre Muskeln atrophisch – sie bauten sich einfach ab. Es dauerte Monate, bis sie sich von diesen Medikamenten erholt hatte und über ein Jahr, bis sie ihren Muskelstatus wieder auf den Stand von vor den Tabletten gebracht hatte. Wie Sophie gestrickt ist, erahnt man, wenn man hört, dass sie in dieser Zeit ein Studium begann. Allerdings forderte das Studium der Kunstgeschichte und Musikwissenschaften sie derart, dass sie permanent mit starken Schmerzen in der Uni saß und danach zu Hause ins Bett fiel. Aufgrund dessen hatte sie zu ihrer Studienzeit kaum Freunde und keine Chance, neben dem Studium zu arbeiten. Das Geld fehlte an allen Ecken und Enden. Sie war ehrgeizig und sie wollte ein Leben wie jeder andere, aber dies ist nun mal nicht zu erzwingen. Irgendwann schaffte sie nur noch die Hälfte ihres vorgesehenen Stundenpensums an der Uni und musste es schlussendlich ruhen lassen.
Nach langen Monaten waren nun endlich alle Medikamente abgesetzt, bis auf Insulin. Für Sophie war klar: Sie ist austherapiert, sie hat endlich ein Anrecht auf Cannabis als Medizin! Sie wollte sich nun einen Psychiater suchen, dem sie vertrauen konnte, einen, der sie ernst nahm und ihr wirklich helfen wollte. Sie meldete sich daraufhin bei ihrem alten Psychiater in Ulm, da sie mit ihm damals ausschließlich gute Erfahrungen gemacht hatte, doch dieser hatte leider Berührungsängste. Cannabis als Medizin war erst ein Jahr alt und die meisten Ärzte trauten sich einfach nicht heran an das Thema. Verständlich, denn Schulungen, Briefings und Dosierungsempfehlungen gab es nicht (was bis heute nicht viel anders ist), dafür aber die Angst vor hohen Strafen, Verlust der Approbation oder finanziellen Unwägbarkeiten. Niemand wusste, was er darf und was nicht. Das verhielt sich mit den Apotheken zu der Zeit nicht viel anders.
Sophie berichtet, dass es ihr in diesem Jahr mit vielen Ärzten so ging, sie es aber niemandem übel nahm – es war einfach eine bescheidene Zeit. Der Arzt ihres Vertrauens war dies allerdings nicht ohne Grund. Er gab ihr die Adresse eines Kinderarztes, bei dem sie eine Chance bekommen sollte. Eigentlich hätte sie bei diesem gar keinen Termin erhalten, doch sie war über ihren Vater privat versichert, was ihr diese Tür auf irgendeine Art öffnete. Sie sagte, sie weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie dieses Privileg nicht gehabt hätte. Ihre Eltern waren ursprünglich gegen Cannabis gewesen, aber nur so lange, bis sie sahen, was die Antidepressiva mit ihr machten. Das wollten auch sie nie wieder erleben und unterstützten sie von da an bei ihrem Vorhaben. Sie sagt, sie sei sehr stolz auf ihre Eltern, dass sie bereit waren, dazuzulernen und ihr zu vertrauen.
Der Kinderpsychologe war jedenfalls ein Segen. Er setzte mit ihr unverzüglich einen Antrag auf Kostenübernahme auf, welche im Februar 2018 umgehend bewilligt wurde. Endlich war Sophie am Ziel, sie konnte es kaum fassen. So auch die Krankenkasse, welche aufgrund eines bürokratischen Fehlers noch im selben Jahr, und zwar pünktlich zur Mary Jane Berlin die Zahlung des Medikaments einstellte. Sophie rationierte umgehend ihre Medizin, weil sie Angst hatte, in der Zeit ausgestellte Rezepte selbst zahlen zu müssen. Verständlich, denn sie ist auf eine sehr hohe Dosis eingestellt, welche sie monatlich (je nachdem was das Cannabis in der Apotheke gerade kostet) 1500 bis 2000 Euro kosten würde. Inzwischen hat Sophie keine Probleme mehr mit der Kasse, allerdings macht sie sich Sorgen, das sie ab dem 25. Lebensjahr nicht mehr familienversichert sein kann. In anderthalb Jahren muss sie die Kasse wechseln und hofft, dass es nicht dasselbe Problem gibt wie mit den meisten Ärzten. Diese machen nämlich gefühlt mehr Probleme, seit sie ein Rezept hat.
Ich glaube, es liegt daran, dass ich jung bin und Cannabis möchte. Sie denken, ich will mir Drogen erschleichen
Sophie
Auf die Frage, was sie glaubt, woran das liegen könnte, antwortet sie: “Ich glaube, es liegt daran, dass ich jung bin und Cannabis möchte. Die meisten Ärzte glauben, dass ein so junger Mensch noch nicht krank genug sein kann, um Cannabis zu brauchen. Sie denken, ich will mir Drogen erschleichen.” Eine dieser Geschichten muss erzählt werden, weil sie so widerlich ist, verzeiht mir. Sophie war bei einer Ärztin in München, die ihr ein Rezept ausstellen sollte. Sophie war lange Patientin, die Dosis und Indikation waren klar und die Ärztin stellte ihr Rezept normalerweise anstandslos aus. Doch dann ging die Dame in den Mutterschutz, leider ohne Sophie vorher zu informieren. Ungünstig, denn Ärzte die ein Cannabisrezept ausstellen, sind rar. Auch wenn man schon lange Patient ist. Sie war allerdings nicht alarmiert, denn sie hielt die Praxis für pro Cannabis, hatten sie ihr doch über ein Jahr ihre Rezepte ausgestellt. Die vertretende Ärztin sah das allerdings alles etwas anders und wollte ihr gegen die Schmerzen ausschließlich CBD aufschreiben. Sie war tatsächlich so schlecht informiert, dass sie dachte, THC wäre gegen Schmerzen gar nicht wirksam. Sie versuchte händeringend, der Ärztin die Benefits ihres Medikaments zu erklären, setzte auseinander, dass die Linderung bei Weitem nicht nur den Schmerz betraf, doch vergebens.
Sie biss auf Granit, solange bis ihr klar wurde, dass sie vielleicht ab sofort ohne ihr Medikament wäre. Sie kämpfte, sie redete, sie wurde panisch. Die Ärztin ließ sie tatsächlich bis zu einer Panikattacke auflaufen und fuhr dann auch noch selber hoch. Sie sagte ihr, man könne sich als Patient nicht derartig verhalten und unterstellte ihr, sie versuche, die Ärztin zu manipulieren, um Cannabis zu erhalten. Diese Ärztin hatte übrigens initial mit ihrer psychotherapeutischen Fortbildung geprahlt und ihr dann glücklicherweise ein einziges Rezept ausgestellt, dass sie erst mal über die nächsten 4 Wochen rettete. Diese lebte sie allerdings im Vollstress, wie sie berichtet. Innerhalb von 4 Wochen einen neuen Arzt in ihrer Nähe zu finden, war für sie körperlicher wie emotionaler Hochstress, was sich wiederum extrem negativ auf ihre Erkrankung auswirkte. Sie fand einen Arzt, so wie sie sich bei allen anderen Unwägbarkeiten auch geweigert hatte aufzugeben. Diesen Arzt hat sie heute noch und ist unglaublich glücklich darüber, wie sie sagt. Allerdings empfand sie es als großen Shock, nach Monaten erfolgreicher Verschreibungen als Junkie (wortwörtlich) abgestempelt zu werden, weil eine Ärztin CBD für das einzige wirksame und verschreibungsfähige Medikament hält.

Das dabby End
Sophie ist nun seit über 3 Jahren legale Cannabispatientin. Der Großteil der Konsumenten sind in meinen Augen Patienten wissentlich oder unwissentlich, nur leider meist nicht legal. Sie hat viele Dinge für sich über ihr Medikament herausgefunden und ihre Konsumform derart optimiert, dass sie sagen kann, es geht für sie nicht besser. Dass sie herausgefunden hat, dass ihr Cannabis fast ausschließlich oder zumindest deutlich besser ohne Tabak hilft. Es beruhigt und bringt so den Kreislauf, den Stoffwechsel und so auch ein überreiztes Nervensystem zur Ruhe. “Mit Tabak hat mir Cannabis gar nicht gegen die Übelkeit geholfen, ganz im Gegenteil, es hat sie eher hervorgerufen!” Wenn ihr also das Herzrasen und den Schwindel nach einem großen Kopf oder einen Zug am Joint kennt – das ist euer Tabak. Seit sie ein Rezept hat, hat sie sich vom Rauchen distanziert, da es einfach nicht die idealste Konsumform für jemanden ist, der für den Rest seines Lebens hoch dosiertes Cannabis konsumieren muss.
Mit Tabak hat mir Cannabis gar nicht gegen die Übelkeit geholfen, ganz im Gegenteil, es hat sie eher hervorgerufen!
Sophie
Erst hatte sie sich für das Vaporisieren von Blüten mit einem Mighty entschieden, was ihr aber nach einem Jahr unheimlich auf die Stimme ging. So begann sie mit Extraktion zu experimentieren und hat nun ihr Optimum erreicht. Sie extrahiert ihre Blüten aus der Apotheke mit einer Rosinpresse, also lösungsmittelfrei. Die Extrakte dabbt sie und das übrig gebliebene Material verbackt sie zu Edibles. Sie sagt selbst, dass sie das Gefühl hat, ihrem Körper auf diese Art so wenig wie möglich zu schaden, alles fühlt sich richtig und gut an. Ihre größten Probleme, Schmerzen und Erschöpfung durch schlechten Schlaf, sind extrem gelindert. “Cannabis ist unschlagbar!”, sagt sie, “Es hat für mich keine Nebenwirkungen, und dadurch, dass ich permanent einen so hohen Spiegel habe, bin ich auch nie richtig “bekifft”.”
Cannabis ist unschlagbar!
Sophie
Damit meint sie natürlich, dass ihre Kognition im Alltag nicht eingeschränkt ist. Sie nimmt gegen ihre anderen Krankheiten schon unzählige Tabletten und ist froh, dass es mit Cannabis im Gegensatz zu den damals aufgezwungenen Antidepressiva nicht zu Wechselwirkungen kommt. Sophies Schmerzen sind natürlich nicht verschwunden, genauso wenig wie ihre anderen Erkrankungen. Sie hat nun sogar einen Behindertenausweis über 50 %, was unheimlich wichtig ist. Er wird ihr ihr Leben nach einem lebenslangen Kampf endlich etwas erleichtern. Sie hat Lebensqualität, vielleicht zum allerersten Mal. Sie wird nun endlich sogar eine Ausbildung anfangen. Eine, die ihrem angestrebten, aber nie beendeten Studium sehr nahekommt. Und wenn Sophies Geschichte eines in die Welt schreit, dann ist es: GEBT NIEMALS AUF!