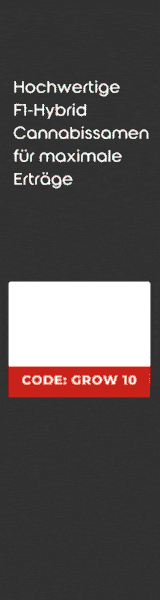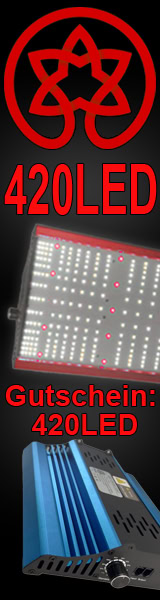Maria ist 40 Jahre alt, und in einem 500 Seelen Dorf aufgewachsen. Maria war als Kind schon depressiv, ohne es zu wissen. Seit sie vier Jahre alt war litt sie unter Bauchschmerzen, Ohrenentzündungen und ständig wiederkehrenden Infekten, denn bei depressiven Kindern zeigt sich die Depression über somatoforme Störungen. Somatoforme Störungen sind reelle körperliche Beschwerden, für die allerdings oft keine physische Ursache finden lässt, deren Symptome jedoch deutlich nachweisbar sind.
Auch damals litt sie schon unter Derealisierungen und Depersonalisierungen, Zeichen der Flucht einer Kinderseele in eine parallele Realität, eine Realität, in der sie überleben konnte. Die Erlebnisse, die diese Problematik auslösten, sollten Marias gesamtes Leben bestimmen, doch sie zwangen sie nicht in die Knie. Nach unfassbarem Leid, Ärzten, die in einem Spektrum von Lebensretter bis “Job verfehlt” angesiedelt waren und einem schweren Unfall, bog sie durch einen Freund mit einer Sativex – Unverträglichkeit, doch noch an der letzten Ausfahrt ab, und ließ sich von Cannabis retten. So entstand eine endlos erscheinende Geschichte in zwei Teilen – denn am Stück kann man sie schwer verkraften.

Eine Kindheit hinter Fassaden
Maria hatte keine schöne Kindheit, auch wenn das niemandem auffiel. Das Letzte, was eine dysfunktionale Familie aufrechterhält, ist oft ihre Fassade. Um zu verstehen, woran Maria in einem so zarten Alter, so sehr kaputt gegangen ist, müssen wir mit ihr in ihre Kindheit reisen. Marias Eltern unterhielten ein Geschäft, waren im Dorf wohlbekannt, und eigentlich ganz normale Mittelschichtler. Sie und ihre beiden Brüder, von denen einer älter und einer jünger ist, haben nicht alle dasselbe Schicksal erlitten; Maria traf es als einziges Mädchen, und mittleres Kind, besonders hart. In ihrer Familie herrschte Gewalt, Gewalt in einer Zweckgemeinschaft, in der sich niemand ernsthaft für den anderen interessierte, es sei denn, man konnte ihn unterdrücken.
Die einzige Reaktion, die Maria bei Traurigkeit oder Angst in ihrer Kindheit erfuhr, war: “Was hängst schon wieder die Gosch so runter?” Die Gewalt und Überforderung der Eltern gipfelten beispielsweise im Woolworth, wo Maria mit anfallsartigen Bauchschmerzen zusammenbrach. Der Vater, welcher in dieses Verhalten interpretierte, dass Maria bockig sei, verprügelte sie mitten im Laden. Später stellte sich heraus, dass sie seit Monaten an einem Magenpilz litt, welcher nun fast zum Magendurchbruch geführt hatte. Als Maria 3 Jahre alt war, begab es sich, dass ihre Mutter sie zu einem Arzt brachte, wo sie sich ausziehen sollte. Das kleine Mädchen weigerte sich, und der Arzt entkleidete sie gewaltsam. Ihre Mutter schritt nicht ein. Mit 5 versuchte sie sich das erste Mal umzubringen, indem sie beim Skiurlaub einfach auf einen Abhang zufuhr, es war nicht geplant, es war eine Übersprungshandlung. Ein Mann mit weißer Skijacke packte sie, brachte sie zurück auf den Trail, und sagte: “Aufpassen!”, erinnert sie sich.
Später folgten weitere Selbstmordversuche, doch der Umstand, als Kind auf einen solchen Gedanken zu kommen, bildet die Welt ab, in der Maria groß wurde. Dieser Urlaub war auch eine besondere Belastung, denn wie sie später herausfand, waren es nicht nur Urlaube. Der Vater hatte Affären, und zwar ausgerechnet dort, wo sie zweimal jährlich Urlaub machten. Später wollte er seine Familie sogar für eine der Frauen verlassen, da mindestens ein Kind entstanden war, tat es dann aber doch nicht. Dieser spezielle Urlaub war so belastend, weil bei der Buchung ein Fehler unterlaufen war. Die Betten mussten geteilt werden, und aus unerfindlichen Gründen, schlief Maria mit ihrem Vater in einem Bett; sie erwachte nachts mehrmals und fühlte sich unwohl, kann sich aber noch nicht wieder erinnern, was genau passiert war. Traumata werden oft abgespalten, und eine Depression kommt selten allein; meist kommt sie in solchen Fällen mit ihren Freunden Angststörung, Sozialphobie, PTBS und Dissoziationen.
Maria kann sich also an vieles viel zu gut erinnern, und an manches gar nicht oder schlecht. Maria war zu der Zeit nicht klar, dass etwas nicht stimmte, denn dies war ihre Welt. Sie hatte Depressionen und Schmerzen, seit sie auf der Welt war, für sie war es der Normalzustand. Und auch ihre Eltern litten unter psychischen Problemen. Ihr Vater war Borderliner, und auch ihre Mutter hatte eine schwere Kindheit, später auch einen Nervenzusammenbruch und schloss sich zeitweilig sogar einer Sekte an. Nach dem Nervenzusammenbruch der Mutter, Maria war 9, ließ ihr Vater sie (die Mutter) in eine geschlossene Klinik einweisen; bis heute hat Maria nicht erfahren, was der Grund dafür war. Wenn man allerdings die Geschichte von einer Mutter hört, die später mit einem Messer auf ihr erwachsenes Kind losgeht, weil sie im Wahn denkt, sie wolle sie vergiften, war eine Einweisung damals schon vielleicht doch nicht so abwegig. Zuhause war nichts stabil, und so bekam Maria auch keine Hilfe.
Niemand kam auf den Gedanken, sie bräuchte eine Psychotherapie, denn sie versuchte ihre Probleme so gut wie möglich zu verstecken. Sie sagt, hätte sie ihre Probleme erwähnt, hätte ihre Mutter ohnehin nur gemault, also ließ sie es. Sie ist Weltmeisterin im Aushalten, sagt sie. Die Schule machte ihr dieses Unterfangen nicht einfacher, denn mit einer Angststörung zwischen 30 Klassenkameraden zu sitzen, Brüste zu kriegen, Ausschlag vom Darmpilz und die Stimmungsschwankungen durch die sich verschlimmernde Depression, machten jeden Tag zu einem Spießroutenlauf.
Auch Freunde hatte Maria wenige, was sich bis heute nicht geändert hat. Die meisten Menschen haben für die Bedürfnisse traumatisierter Personen leider kaum Verständnis. Ihre Depressionen, Sozialphobie und Angststörung wurden also in Richtung Pubertät schlimmer, und zwar so schlimm, dass sie irgendwann nicht mal mehr einen Aufzug betreten konnte, obwohl es dazu gar kein spezifisches Trauma gab. Ihre Eltern nahmen sie unverändert nicht ernst, und schoben ihr Verhalten auf die Fernsehserien, die sie schaute. Echtes Interesse bestand nie

Trauma auf Reisen
Da man seine Probleme nicht an einem Ort lassen, und umziehen kann, nahm Maria ihre Probleme mit in ihr Leben. Eigentlich war ihr ja gar nicht recht bewusst, dass sie welche hatte; so surreal das auch klingt. Erst der spätere Tod ihres Vaters, welcher eine äußerst groteske Situation in ihrem Beisein war, und ein Herzstillstand vor einer Operation lösten bei ihr die starken Depersonalisierungen und andere Symptome der PTBS aus, die sie schlussendlich Hilfe suchen ließen. So arbeitete sie im Jahre 2008 schließlich in einer Firma, in der sie Schichten stemmen musste. Schichtarbeit macht krank, das belegen Studien, die man, ist man im Besitz eines gesunden Menschenverstandes, aber eigentlich nicht braucht.
Maria wurde von ihren Eltern zuvor zu einer Lehre gezwungen, die sie nicht wollte, und so griffen sie auch massiv in ihr zukünftiges Leben ein. Deshalb litt Maria zusätzlich unter der Art ihrer Arbeit, da sie ihr wie eine Selbstgeißelung vorkam. Außerdem hielt auch Maria, wie viele andere, die ständigen Schichtwechsel nicht lange durch, ohne zu Schlaftabletten zu greifen. Sie hatte sich gerade eine Eigentumswohnung gekauft, und war auf den Job angewiesen, um diese abzuzahlen. Denn wieder war Angst im Spiel, diesmal die Angst, alles wieder zu verlieren, was sie sich aufgebaut hatte. Sie dosierte höher und höher, da gerade bei Schlaftabletten sehr schnell eine Gewöhnung einsetzt.
Bis sie eine Überdosis hatte; 16 Tabletten hatte sie sich eingepfiffen, und das nicht zum letzten Mal. Als sie zum zweiten Mal überdosiert zusammenbrach, gestand sie sich noch immer nicht ein, dass sie tablettenabhängig war. Als sie zurück in ihren Beruf sollte, wehrte sich ihr Körper, sie bekam eine heftige Lungenentzündung. Die zugrundeliegende Problematik nennt sich wieder einmal somatoforme Störung. Zwei Wochen lang war Maria schwer krank, doch als wieder arbeiten sollte, wehrte sich ihr Körper abermals – diesmal mit Panikattacken. Daraufhin suchte sie endlich einen Arzt auf, dieser stellte die Abhängigkeitsproblematik fest, und erkannte auch als Erster die Angststörung. Endlich war ein erster Grundstein, für irgendeine Form von Hilfe gelegt. Aber bis sie diese bekam, floss noch viel Wasser die Spree hinunter.
Die Suche nach wirklicher Hilfe
Von ihrem Arzt bekam sie Mirtazipin, ein beruhigendes Antidepressivum, dass sie jedoch überhaupt nicht vertrug. Sie schlief 12 Stunden am Stück wie eine Tote, danach war sie eine Stunde wach, und musste sich wieder schlafen legen. Sie rief ihren Arzt an, und erklärte ihm das Problem, welcher sie anhielt, die Tabletten weiter zu nehmen. Er sagte ihr, dass sich die Nebenwirkungen bessern würden, was allerdings nicht der Fall war. Weiter ging es mit Doxepin, was ihr zwar zu einem vernünftigen Schlaf verhalf, allerdings einen starken “Kater” am nächsten Tag hinterließ – dies war also auch nicht ihr Medikament. Für Menschen, die den Horror einer Einstellung auf Psychopharmaka noch nicht durchmachen mussten, sei erklärt, dass die Wirkung der meisten Antidepressiva erst nach drei bis vier Wochen einsetzt, die Nebenwirkungen allerdings sofort. Ich möchte diese nicht weiter erläutern, und rate von jedem Googeln ab; stattdessen googelt besser den Nocebo Effekt.
Beim nächsten Besuch des Psychiaters wurde Citalopram verschrieben, ein häufig verschriebenes, und mit einem, im Verhältnis zu anderen, geringen Nebenwirkungsprofil aussichtsreiches Antidepressivum. Sie sollte ihre Dosierung nach und nach von 20mg täglich, auf 40mg steigern. Als sie bei 80mg angelangt war, sehnte sie schon dem in zwei Wochen folgenden Arzttermin entgegen – so konnte es nicht weitergehen. Der Arzt reagierte unwirsch und schockiert mit der Frage, ob sie verrückt sei; sie hätte sich täglich stark überdosiert. Daraufhin fragte sie, ob eine stationäre Reha, auf der sie begleitend auf Medikamente eingestellt werden, und auch dem Druck zur Arbeit zu müssen entfliehen könnte, nicht die sicherere und somit bessere Alternative wäre.
Man schickte sie mit ihrer Bitte zum Hausarzt, welcher den Antrag stellte. Dieser wurde von der Krankenkasse umgehend abgelehnt, aber dass Maria niemand ist, der aufgibt, sollt inzwischen jedem klar sein. Sie legte Widerspruch ein, doch vergebens. So versuchte man sie zwanghaft wieder in ihren Beruf einzugliedern, obwohl sie Ruhe, Medikamente, Unterstützung und Begleitung gebraucht hätte…was im Mai 2012 einen erneuten Selbstmordversuch nach sich zog. Sie bekam ihre Reha später noch, doch das Warten auf ungewisse Hilfe, der finanzielle und behördliche Druck und das Gefühl, von niemandem gesehen zu werden, hatten ihr alle Hoffnung geraubt. Nach 6 weiteren Monaten Kampf, bekam sie nun endlich ihre Zusage zur Reha – endlich traf sie auf Menschen, die ihr wirklich halfen, statt an ihr vorbei zu behandeln.
Sie fand dort eine tolle Psychotherapeutin, welche gerad erst ihre Ausbildung beendet hatte. Sie steckte voller Energie, Empathie und dem Willen zu helfen, statt pünktlich im Feierabend zu sein. Endlich bekam sie ihre Diagnosen, und sogar ihre Reha wurde von 4 auf 8 Wochen verlängert – Maria sagt über diese Erfahrung: “Ohne sie wäre ich nicht mehr da, sie hat mir das Leben gerettet. Eigentlich hätte ich in die Geschlossene gehört.” Sie hatte sogar während der Reha einen Nervenzusammenbruch, weil sie nicht mehr heim wollte, doch sie wurde so gut betreut, dass sie die Reha nach 8 Wochen stabil verlassen konnte. Die dortige Therapeutin ging weit über die Grenzen dessen, was ihre berufliche Pflicht gewesen wäre. Sie behielt Maria als Patientin, und zwar ohne die Sitzungen abzurechnen. Sie war ausschließlich befugt, stationäre Therapien abzurechnen, und dennoch behandelte sie Maria über zwei Jahre lang telefonisch ambulant weiter.

Heilung heißt verstehen
Als Maria wieder zu Hause war, suchte sie sich zur unterstützenden Begleitung auf ihrem Weg zurück in ein neues, gesundes Leben eine Tagesklinik, in der sie im Handumdrehen aufgenommen wurde. 6 Monate lang war sie von 8 bis 16 Uhr dort, um an ihren Depressionen, der Angststörung, der PTBS und ihren Somatisierungen, den Dissoziationen und der Derealisation zu arbeiten, außer an den Wochenenden, an denen sie Zeit für sich hatte. Diese Unterstützung gab ihr die Kraft, über Umwege wieder am Berufsleben teilzunehmen. Ihre harte Arbeit an sich selbst brachte sie zu der Entscheidung, eine tiefenpsychologische Therapie zu beginnen. Auch ihre beiden Antidepressiva nahm sie weiterhin, doch nach 4 Jahren fing der Körper an sich zu wehren, und die Nebenwirkungen nahmen zu.
Sie sagte sich: Wenn mein Körper die Medikamente ablehnt, dann braucht er sie wohl nicht mehr. Die Psychiaterin, welche die Tabletten damals verschrieben hatte, versuchte sie hartnäckig dazu zu bewegen, diese nicht abzusetzen, doch für Maria hatten sie keinen Nutzen mehr. Sie war ausschließlich sediert, die Angst und die Depression drückten deutlich durch. Sie entschied sich dafür, das Citalopram abzusetzen, und das Doxepin weiter zu nehmen; für den Schlaf, denn ohne hatte sie Wahnvorstellungen. Aber glücklich war sie mit dieser Entscheidung nicht, sie wollte weg von der Chemie – ihr Körper litt.
Ein wegweisender Unfall
Maria arbeitete zu dieser Zeit handwerklich im Freien, ein Job, der ihr Spaß machte und ihre Selbstwirksamkeit stärkte. Nur im Winter mochte sie ihn nicht, denn Dunkelheit, Nässe und Kälte schlugen ihr aufs Gemüt. An einem nebligen, nassen Tag arbeitete sie gemeinsam mit einem Kollegen. Als dieser kurz unaufmerksam war, traf er Maria mit einer Maschine mit voller Wucht am Kopf, und schleuderte sie gegen ein Auto. Statt einen Krankenwagen zu rufen, fuhr sie auf eigene Faust ins Krankenhaus, wo eine Anamnese erstellt und sie auf kognitive Beeinträchtigungen geprüft wurde. Außer ein paar kleiner Tests geschah nichts, kein Röntgen, kein CT. Sie wurde eine Nacht zur Überwachung dabehalten, und am Morgen nochmals auf Anzeichen einer heftigeren Verletzung untersucht.
Daraufhin wurde sie mit der Diagnose “leichte Gehirnerschütterung” und Ibuprofen nachhause geschickt. Am Folgetag hatte sie plötzlich starke Schmerzen, und am Montag gesellten sich Sehstörungen und eine leichte Lähmung einer Gesichtshälfte ein und ihr Ohr stellte teilweise den Dienst ein. Sie rief in Panik ihren Hausarzt an, der sie mit Verdacht auf Hirnblutung sofort erneut ins Krankenhaus schickte. Dort musste sie erst einmal 3 Stunden warten, was in einer Notaufnahme normal, mit einem akuten Problem und einer Angststörung allerdings ein ziemliches Drama ist. Kurz darauf wurde endlich von einem Arzt ein CT gemacht, und ein Haarriss in ihrem Schädel gefunden. Die Diagnose änderte sich also von Gehirnerschütterung auf Schädelbruch, und mit diesem wurde sie sage und schreibe eine ganze Woche krankgeschrieben.
Da die Schmerzen nach einer Woche nicht abgenommen hatten, ging sie zum Arzt und hängte eine Woche dran, was ebenfalls nicht ausreichte. Wieder ging sie zum Arzt und beschrieb Schwindel und Schmerzen, und das deutliche Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ihr Arzt schrieb sie nochmals zwei Wochen krank und verwies sie auf nimmer Wiedersehen der Praxis; er glaubte ihr offenbar nicht. Nach diesen zwei Wochen schleppte sie sich die zwei Folgenden zu einer Arbeit, die kaum noch zu bewältigen war. Nach zwei Wochen hielt sie es nicht mehr aus und rief erneut beim Krankenhaus an, welches sie aufgrund von Auslastung auf den nächsten Tag vertröstete. Als sie endlich vorstellig wurde, schickte man sie ins Unfallkrankenhaus, da ihr dort besser geholfen werden könne. Im MRT stellte man keine Mikroblutungen fest. Ihre Beschwerden und andauernden Schmerzen wären allerdings typisch für diese und können sich ohne adäquate Schmerztherapie schnell chronifizieren.
Sie bekam starke Opioide (Oxicodon und Tillidin), welche sie zwei Wochen lang nehmen sollte – Opioide bergen ein hohes Abhängigkeitspotential, und werden deshalb nicht dauerhaft eingesetzt, wenn der Schmerz nicht chronisch ist. Durch die Schmerzmedikation war ihr Schmerz nun von einer 8 auf eine 5 gesunken, und sie wurde zurück in ihren Job gezwungen. Die Berufsgenossenschaft mache Druck, wurde ihr gesagt, und gleichzeitig wurde ihr Einwand, sie könne auf Opioiden nicht an schweren Maschinen arbeiten, komplett ignoriert. Menschen, die es im Leben schon immer schwer haben, passen scheinbar nicht in unsere Leistungsgesellschaft. Ihnen wird Faulheit, Unzuverlässigkeit und Unwillen vorgeworfen, nur weil sich Menschen, die solche Entscheidungen fällen, so viel Leid auf einem Haufen einfach nicht vorstellen können…
4 Tage nach Wiedereingliederung in den Job wurde ihr das erste Mal wieder schwarz vor Augen – im Auto; am Tag darauf kippte sie im Betrieb vor Schmerzen um und war ohnmächtig. Beim nächsten Arzt fand man nun endlich, zusätzlich zu den bisherigen Diagnosen, einen durch ein Schleudertrauma eingequetschten Nerv. Doch da sie bereits 3 Monate mit ein und derselben Erkrankung, die nur niemand richtig behandelt hatte, krankgeschrieben war, war eine erneute Krankschreibung, vor allem beruflich, sehr problematisch. Nach weiteren Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten, einer halbwegs erfolgreichen Behandlung bei einer Osteopatin, mehreren Akupunktursitzungen, einer vierwöchigen Reha und einem MDK der zur Arbeit drängt, stellte nun eine Ärztin in den Raum, dass die Schmerzen auch psychischer Natur sein könnten.
Es sei nur am Rande erwähnt, dass sie von der Berufsgenossenschaft in ein Krankenhaus geschickt wurde, um zu checken, wie krank sie wirklich ist – ironischer Weise war es ein Krankenhaus der… naaaaa…Berufsgenossenschaft, richtig! Und so kam es, dass weder die Berufsgenossenschaft zahlen wollte, da nicht mehr eindeutig war, ob die Schmerzen vom Unfall herrührten, noch die Krankenkasse, da es in ihren Augen ein Arbeitsunfall war. In Deutschland schachert man darum, wer den Kranken eher verhungern lassen darf, und das legal. Maria hatte keine Lebensqualität mehr, wollte keine Tabletten mehr nehmen, und war 24/7 dissoziativ – und so begann ihr Kampf auf eigene Faust.

Drogen nehmen?
Wir alle kennen diese stundenlangen Google-, Youtube- und Blogreisen, auf die wir uns begeben haben, als Cannabis interessant wurde. Menschen aus meiner Generation erinnern sich wahrscheinlich eher noch an die Bücher, die man im Freundeskreis verliehen und vor seinen Eltern versteckt hat. Auf diese Reise begab sich nun auch Maria und wurde fündig. Zuerst interessierte sie sich für CBD und seine angstlösende Wirkung, vor allem, da es nicht psychoaktiv war. Dazu muss man wissen, dass Maria in einem bayerischen Dorf aufgewachsen ist und ihre Eltern auch in Sachen Aufklärung ganze Arbeit geleistet haben, ebenso wie in Sachen Fürsorge und Empathie. *irony off* Eigentlich hatte sie in ihrer Gegend gar keine Berührung mit illegalen Substanzen, doch in ihrer Straße wohnten vier Jungs, von denen sich erzählt wurde, sie seien alle schwer drogenabhängig.
Zwei von ihnen haben es herausgeschafft, die anderen beiden haben sich einen goldenen Schuss gesetzt. Initial hätten sie nur Gras geraucht, same old story; und so wurde allen Kindern im Dorf die Geschichte immer wieder erzählt; in der Form kontraproduktiv, auch wenn der Kern der Wahrheit entspricht. Und wer weiß, wie viele Kinder nicht mit Angst reagiert haben, wie Maria, sondern mit Neugier und Rebellion. Wenn Eltern und Politiker nur wüssten, was sie mit dieser Art der “Aufklärung” anrichten. Jedenfalls hatte sich Maria vor ihrem ersten Kauf des Öls monatelang belesen, mit dem Preis hatte sie noch etwas Bauchschmerzen, doch sie wollte nichts unversucht lassen. Außerdem war der Gedanke, ein natürliches einzunehmen, sehr beruhigend. Schlussendlich nahm sie es in einer niedrigen Dosierung, und sie wurde nicht enttäuscht.
Ihre körperlichen Beschwerden waren konnte sie nun besser aushalten, da sie nicht mehr so präsent waren; sie konnte sich von ihnen distanzieren. Doch ihre Psyche war wie ausgetauscht – es ging ihr deutlich besser, und eigentlich ist auch ihre Distanz zum Schmerz als eine psychische Wirkung einzustufen. Als Nächstes wollte sie CBD Blüten ausprobieren, fand aber keine hochpotenten Produkte. Doch nicht mit Maria, sie war jetzt auf IHREM Weg, und niemand konnte sie aufhalten. Sie fuhr bis in die Schweiz, was mit dem eigenen Auto keine Weltreise war, und besorgte sich Blüten mit einem CBD Anteil von 26 % – Tschakka! Doch mit einer Angststörung müssen Lösungen sich nicht immer anfühlen wie welche, und so saß sie mit akuter Panik daheim und dachte immer wieder: ”Drogenschmuggel, Drogenkonsum – was mache ich hier eigentlich?”
Und dann tat sie es – “Probier’s einfach probier’s! So kann es doch eh nicht weitergehen!”, dachte sie, und los ging es. Psychisch und damit auch muskulär wichen die Anspannung in hohem Maße, und auch körperlich, also gegen die Schmerzen ihres Schleudertraumas, halfen die Blüten – allerdings eher in der Form, dass sie sie einfach sein lassen konnte, statt massiv unter ihnen zu leiden. Sie fühlte zum ersten Mal ihre Angst sinken, ihr Selbstbewusstsein steigen, und vor allem: Die PTBS samt ihrer Depersonalisierung und Derealisation nahmen ab. Ein unglaublicher Erfolg.

Angst vorm Retter
Der erste Schritt war getan, Maria vertraute Mary. Doch auch ihre Schmerzen hatten ihre Hausaufgaben gemacht und kamen nach einigen Monaten mit voller Wucht zurück. Drei Monate zuvor hatte ihr ein Freund mit einer chronischen Krankheit ein Fläschchen Sativex geschenkt. Bei ihm wirkte es so stark, dass er jedes Mal nach dem Gebrauch einschlief, also schenkte er es mit wärmsten Empfehlungen Maria. Diese hatte es aufgrund der gelungenen Aufklärungsarbeit ihrer Eltern nicht angerührt. Viel zu große Angst hatte sie vor Rausch, Abhängigkeit und Strafe. Doch als ihre Schmerzen nun auf eine 9 hochschossen, wagte sie den THC-Tango. Eine halbe Stunde später saß sie auf ihrer Couch und strahlte die Wand an – nahezu schmerzfrei. Sie sagte an diesem Punkt des Interviews energisch zu mir: “Der Schmerz ging von 9 auf 2.
Was nicht mal die scheiß Opioide geschafft haben, hat diese kleine Pflanze vollbracht!” Voller Enthusiasmus ging sie zu ihrem Hausarzt in vollem Glauben, er würde sich über ihren Erfolg und neuen Therapieansatz freuen – weit gefehlt. Er sagte ihr, sie solle sofort seine Praxis verlassen, er verschreibe keine Drogen. Dazu ihn zu fragen, wofür er dann seine anderen Medikamente halte, kam sie leider nicht mehr; sie machte auf dem Absatz kehrt und versuchte es bei ihrer Schmerztherapeutin. Diese sind allgemein gebildeter, was Cannabis betrifft, da im Bereich Schmerz schon länger und häufiger mit Cannabis gearbeitet wird. Bei einem Hausarzt hat man meist schlechte Karten – mit Ausnahmen. Ihre Schmerzärztin sagte ihr, dass es möglich wäre, Extrakte zu verschreiben, allerdings keine Blüten. Allerdings sah die Ärztin aus unerfindlichen Gründen keine Chance für eine Kostenübernahme trotz gegebener Indikation. Sie wollte diesen Weg mit Maria nicht gehen, also suchte diese weiter nach dem richtigen Arzt und war in diesem Zeitraum wieder dem Schmerz ausgeliefert.
Nachdem sie wochenlang gefühlt alle Ärzte im Bundesland erfolglos abtelefoniert hatte, fand sie endlich einen Arzt, der ihr wenigstens ein Privatrezept ausstellte; es ist kaum vorstellbar, wie man nach so viel Leid noch bei sich ankommen und ein lebenswertes Leben führen kann. Sie hatte sich bereits endlos über die medizinischen Sorten belesen und wusste genau, was sie wollte. Sie ließ sich ein Rezept über Red No 2 gegen ihre Schmerzen und Red No 4 für die Nacht aufschreiben und verließ mit diesem freudestrahlend die Praxis. Darauf folgten 3 Stunden Autofahrt unter starken Schmerzen, denn die einzige Apotheke mit ihren Sorten befand sich am Bodensee, und sie wollte keinen Tag länger warten. Und dann war es soweit, sie besaß ihr erstes legales Weed. Auch diesmal musste sie sich wieder überwinden, mit einer Angststörung bekommt man sogar manchmal Angst vor den Medikamenten; ein furchtbares Dilemma.
Doch als sie dann endlich einen Zug vom Joint genommen hatte, war sie innerhalb von 10 Minuten schmerzfrei und komplett high. Die Schmerzfreiheit hielt ganze 18 Stunden an, und als sie wiederkam sagte sich Maria, diesmal ganz ohne Anspannung: “Was solls, ich hab ja Gras!” So baute sie über die ersten Tage einen Spiegel auf, indem sie ihr neues Medikament einfach nach Bedarf nahm. Doch eine regelmäßige Einnahme in gleichen Dosen zum Halten des Spiegels, wie sollte das möglich sein? Maria war zwar schmerzfrei, hatte ihre Lebensqualität zurück, und konnte endlich aktiv am Leben teilnehmen, doch wie sollte sie das alles auf Dauer bezahlen? Sie erzählte also alles Geschehene nochmals der Schmerzärztin, welche zwar ihre Unterstützung zusicherte, eine Kostenübernahme jedoch immer noch für unmöglich hielt, da sie nicht austherapiert sei.

Maria war das Kämpfen leid, sie wollte lieber wieder Vollzeit arbeiten gehen, doch auch an eine Wiedereingliederung glaubte die Ärztin nicht. Dass das Medizinstudium kein Modul zur Empathie enthält, muss hier wohl nicht extra erwähnt werden. Maria schaffte es mit Bravour zurück in ihren Job, was die Ärztin überraschte und zu der Aussage bewegte, dass Cannabis der Psyche wohl doch helfe. Ihre Flashbacks waren weg, ihre Stimmung stabil, und sie hatte ihre Depression zum Teufel gejagt. Nach einem halben Jahr bestätigte ihr auch ein spezieller Testbogen, dass das Cannabis ihr geholfen hatte, fast symptomfrei zu werden und sogar ihre Dissoziationen zu besiegen. Ausdrücklich hat sie betont, dass ihr dieser Erfolg nur zuteilwürde, da sie durch das Cannabis deutlich zugänglicher zu einer Therapie wurde, die sie vorher bereits ohne Erfolge ausprobiert hatte.
Auch hier ist also wahrscheinlich eine Medikation samt Therapie sinnvoll, sowie es bei anderen Psychopharmaka auch oft gehandhabt wird. Endlich kann Maria ihre großen Radtouren genießen, wandern gehen und Schnee und Sonne so genießen, wie sie es als Kind nie durfte. Maria zeigt uns allen, dass kein Weg zu weit, kein Kampf umsonst und kein Leben aussichtslos ist. Maria arbeitet inzwischen in ihrem Traumjob, wohnt in ihrer Traumwohnung und behauptet sich auch an allen anderen Fronten. Maria hat nie aufgehört zu glauben, dass sie mehr verdient hat, und ich bin sicher, dass sie das irgendwann auch ihrer Krankenkasse beibringen wird. Sie sucht nämlich nach wie vor einen Arzt, der mit ihr für eine Kostenübernahme kämpft. Wenn sie sich angesprochen fühlen oder einer von euch seinen Arzt empfehlen möchtet, meldet euch per Mail bei mail@rasendereporterin.berlin. Maria ist für jede Hilfe dankbar.