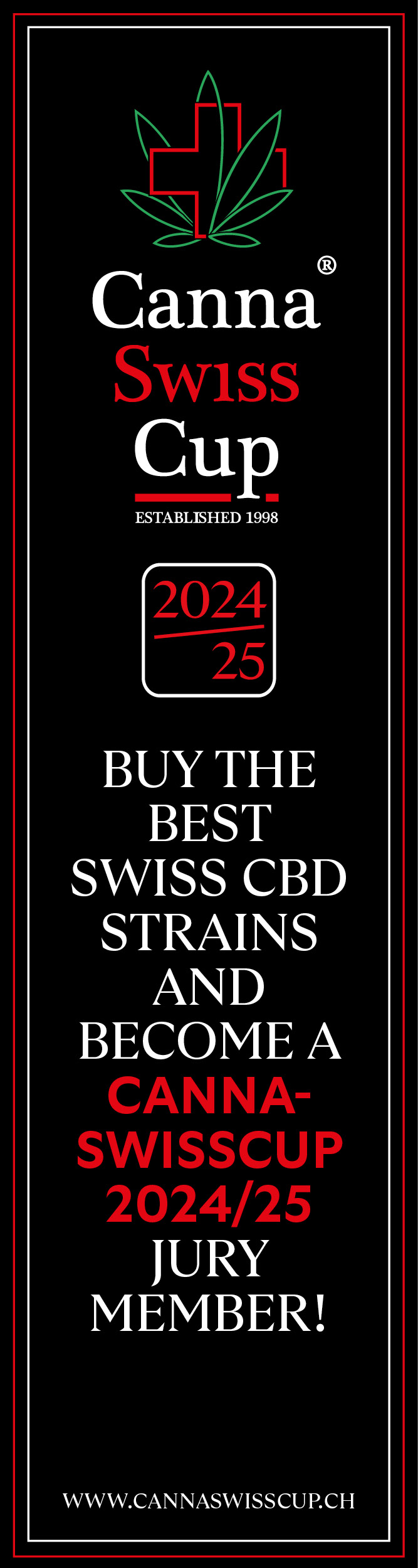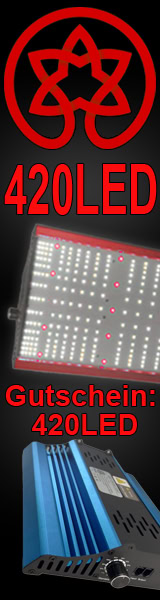Seit 2017 kann medizinisches Cannabis verordnet werden. Grundlage dafür bietet das „Cannabis-als-Medizin-Gesetz“, welches allen niedergelassenen Ärzten ermöglicht, Cannabisblüten und standardisierte THC-haltige Präparate (z. B. Cannabis-Extrakte oder das synthetische Cannabinoid „Nabilon“) zu verschreiben. Ausgenommen davon sind Zahn- und Tierärzte.
Der Gesetzgeber hat das entsprechende Gesetz ausreichend offen formuliert, um dem breiten und vielfältigen therapeutischen Spektrum von Cannabis gerecht zu werden. Die Entscheidung, Cannabis als Medikament zu verordnen, liegt im alleinigen Ermessen des Arztes.
Eine etwaige Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen steht jedoch auf einem anderen Blatt. Laut § 31 Abs. 6 des Sozialgesetzbuches (V) haben „Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung einen Anspruch auf die Versorgung mit Cannabis, (…), wenn eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung (…) nicht zur Verfügung steht oder wenn im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der behandelnden Vertragsärztin oder des behandelnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des Versicherten nicht zur Anwendung kommen kann“.
Bei der erstmaligen Verordnung von Cannabismedikation ist Antrag auf die Kostenübernahme bei der Krankenkasse zu stellen. Über diesen Antrag muss die Krankenkasse innerhalb von drei Wochen entscheiden, bezieht sie in der Entscheidung den medizinischen Dienst (MDK) ein, verlängert sich diese Frist auf fünf Wochen.
Wird der Antrag abgelehnt, kann innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen Widerspruch eingelegt werden. Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren ist eine Klage vor dem Sozialgericht möglich. Auch hier gilt eine Frist von vier Wochen ab dem Eintreffen des Ablehnungsbescheides.

Kostenübernahme für Cannabistherapie: Gesetzliche Krankenkassen mit hoher Ablehnungsquote
70.000 Kostenübernahmeanträge wurden seit dem Jahr 2017 gestellt – von denen jedoch nur ungefähr 60 % genehmigt wurden. Marktschätzungen gehen davon aus, dass derzeit mehr als 80.000 Menschen eine ärztlich verordnete Cannabistherapie durchlaufen, darunter auch Selbstzahler und Privatversicherte. Obwohl die Genehmigung durch die gesetzliche Krankenkasse laut Gesetz (siehe oben) nur in „begründeten Ausnahmefällen“ abgelehnt werden darf, bleibt die Ablehnungsquote seit 2017 relativ konstant bei 40 %.
Die drei größten gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland, Techniker Krankenkasse (TK), Barmer und DAK Gesundheit sehen das Problem in unvollständig oder nicht ausreichend begründeten Anträgen.
Im Positionspapier „Cannabis als Medizin“ des Frankfurter Instituts für Suchtforschung (ISFF) konstatieren die zwölf Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Medizin und Politik:
„Dies kann vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes sicherlich nicht länger mit fehlerhaft gestellten Anträgen begründet werden. Vielmehr verfestigt sich der Eindruck, dass die Krankenkassen – und nicht wie sonst üblich und für richtig befunden die behandelnden Ärzte – die Indikation für eine cannabisbasierte Therapie stellen.“
Wenig Chancen auf Kostenübernahme bei psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen
Aus den Berichten von Betroffenen geht hervor, dass die Kostenübernahme bei bestimmten Diagnosen bis auf wenige Einzelfälle fast immer abgelehnt werden. Nach Daten des BfArM vom März 2020 fallen nur 5 % aller bewilligten Kostenübernahmeanträge auf psychiatrische Erkrankungen (vgl. ISFF (2021)).
So wird die Kostenübernahme beispielsweise bei ADHS regelmäßig (aber nicht ausnahmslos) verweigert, da keine schwerwiegende Erkrankung vorliege und die Verwendung von Cannabis bei ADHS medizinisch zweifelhaft sei, was auch in mehreren Sozialgerichtsurteilen bestätigt wurde.
Ein Gerichtssprecher des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen begründete die Entscheidung wie folgt: „Cannabis soll schwere Krankheiten lindern, es ist keine beliebige Behandlungsalternative oder Hilfe zur Alltagsbewältigung“.
Von ähnlichen Erfahrungen berichten Betroffene von Fibromyalgie und ME/CFS (umgangssprachlich auch: Chronisches Erschöpfungssyndrom).
Die Lebensqualität der Betroffenen ist häufig so stark herabgesetzt, dass ein eigenständiges Leben oder Erwerbsarbeit kaum noch möglich sind. Bis dato existieren keinerlei zugelassenen Medikamente, die Heilung versprechen. Oft berichten die Betroffenen von einer signifikanten Linderung der Symptome durch den Konsum von Cannabis. Die Verbesserungen der Lebensqualität werden in diversen Fallberichten als signifikant beschrieben (Habib/Artul 2018). Dennoch werden Anträge auf Kostenübernahme überproportional häufig abgelehnt.

Allgemein gelten auch (unterstellte) Suchterkrankungen als inoffizielle Kontraindikation für die Kostenübernahme. Darüber hinaus können selbst jahrzehntelang zurückliegende Verurteilungen nach dem Betäubungsmittelgesetz zum Verhängnis werden.
Der Sachverständige für Cannabis-Medikation Oliver Waack-Jürgensen berichtet exemplarisch von einem 56-jährigen Antragsteller, der seit einem schweren Verkehrsunfall an chronischen Schmerzen, sowie einer damit verbundenen depressiven Begleiterkrankung leidet. Der Antragsteller hat die Gutachter der Krankenkasse wahrheitsgemäß über eine mehr als zehn Jahre zurückliegende Verurteilung bzgl. eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgeklärt, sowie über eine mittlerweile überwundene Subtanzgebrauchsstörung berichtet.
Die Krankenkasse lehnte den Antrag ab. Die Begründung: Der Antragsteller sei suchtkrank und labil. Der Fall ging damit weiter an das Sozialgericht, sein Stigma als „vorbestrafter Suchtkranker“ folgte ihm auch dort. Ein Fall, wie man ihn von zahlreichen Cannabispatienten geschildert bekommt.

Ablehnung der Kostenübernahme – oft bleibt nur das Sozialgericht
Anträge auf Kostenübernahme werden auch nach Widerspruch häufig abgelehnt. Der Weg vor das Sozialgericht ist für viele Patienten der letzte gangbare Weg. Offizielle Zahlen existieren dazu zwar nicht, in Gesprächen mit Sachverständigen wie Waack-Jürgensen, sowie in persönlichen Interviews mit Betroffenen wird jedoch klar, dass es ein erheblicher Teil der Cannabis-Patienten ist, die sich ihr Recht erstreiten müssen.
Nicht wenige Menschen scheuen sich vor diesem Schritt – wer ohnehin mit chronischen Erkrankungen kämpft, hat es auch bei einem langwierigen Rechtsstreit nicht unbedingt leicht.
Die gesetzlichen Krankenversicherungen sind laut Gesetz § 12 SGB (V) zur „Wirtschaftlichkeit“ verpflichtet. Von dieser Argumentation wird auch recht unverhohlen Gebrauch gemacht, was die Kostenübernahme von Cannabis-Medikation betrifft. Für die Betroffenen bedeutet dies, dass sie im Zweifel lediglich das günstigere Mittel erstattet bekommen – auch wenn dies teils mit erheblichen Nebenwirkungen einhergeht, wie zum Beispiel beim regelmäßigen Konsum von Opioiden-Schmerzmitteln berichtet.
Viele Cannabis-Patienten werden dadurch unfreiwillig zu Selbstzahlern (gemacht), während andere, mangels finanzieller Möglichkeiten, den illegalen Weg nehmen und sich auf dem Schwarzmarkt versorgen – denn was häufig vergessen wird: Medizinalcannabis ist um ein Vielfaches teurer als „Straßencannabis“ und Eigenanbau.
Cannabis muss als Therapieoption selbstverständlich werden
Die Therapie mittels Cannabis-Medikation ist in Deutschland alles andere als vorbildlich. Seit des Inkrafttretens der Legalisierung von medizinischem Cannabis im Jahr 2017 ist das Land noch immer auf Importe angewiesen, insbesondere was Cannabisblüten betrifft.
Deutsche Cannabispatienten zahlen mit 11-24 €/g ungefähr dreimal so viel, wie in den Niederlanden für das gleiche Produkt verlangt wird – während der private Einkauf und Import von medizinischem Cannabis aus dem Ausland für so manchen deutschen Cannabispatienten mit einer Strafanzeige endet.

Neben der mangelhaften Cannabis-Produktion in Deutschland, sind es vor allem bürokratische Regularien, die den Cannabispreis in die Höhe treiben. In fast allen Bundesländern wird Cannabis als „Rezepturarzneimittel“ behandelt, was einen Preisaufschlag von 90 bzw. 100 % zur Folge hat. Für die Apotheken bedeutet das einen enormen Arbeitsaufwand, der im Grunde problemlos entfallen kann. Schleswig-Holstein geht als einziges Bundesland diesen Sonderweg. Denn ob Cannabisblüten als Fertig- oder Rezepturarzneimittel betrachtet werden, ist Ländersache.
Ein weiteres Nadelöhr sind die Ärzte, von denen nur wenige ausreichend qualifiziert sind Cannabis zu verschreiben. In Deutschland existiert kein Lehrstuhl für Cannabismedizin – ebenso ist die Verordnung solcher Medikation nicht Bestandteil der Ausbildung.
Dazu kommt der hohe bürokratische Aufwand, der mit der Cannabisverschreibung einhergeht, sowie die ständige Gefahr eines Regresses ausgesetzt zu sein, weil die teure Medikation schnell den Budgetrahmen zu sprengen droht. Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg hat deshalb entschieden, Cannabis-Verordnungen nicht mehr in das Arzneimittelbudget einfließen zu lassen – auch diese Lösung wäre schnell umsetzbar, wenn man denn wollte.
Es zeigt sich, dass die derzeitige Situation weder für die Patienten, noch für Krankenkassen, Ärzte und die Cannabisindustrie von Vorteil ist. Der Gesetzgeber hat an vielen Stellen Nachbesserungsbedarf, um die Kosten für das Gesundheitssystem nicht unnötig zu belasten und den Betroffenen eine zufriedenstellende und adäquate Versorgung zukommen zu lassen. Letztlich bleibt auch zu bemängeln, dass die stetigen Forderungen nach „wissenschaftlicher Evidenz“ der Cannabismedikation in starkem Widerspruch zu den fehlenden staatlichen Investitionen in die Forschung einhergehen.