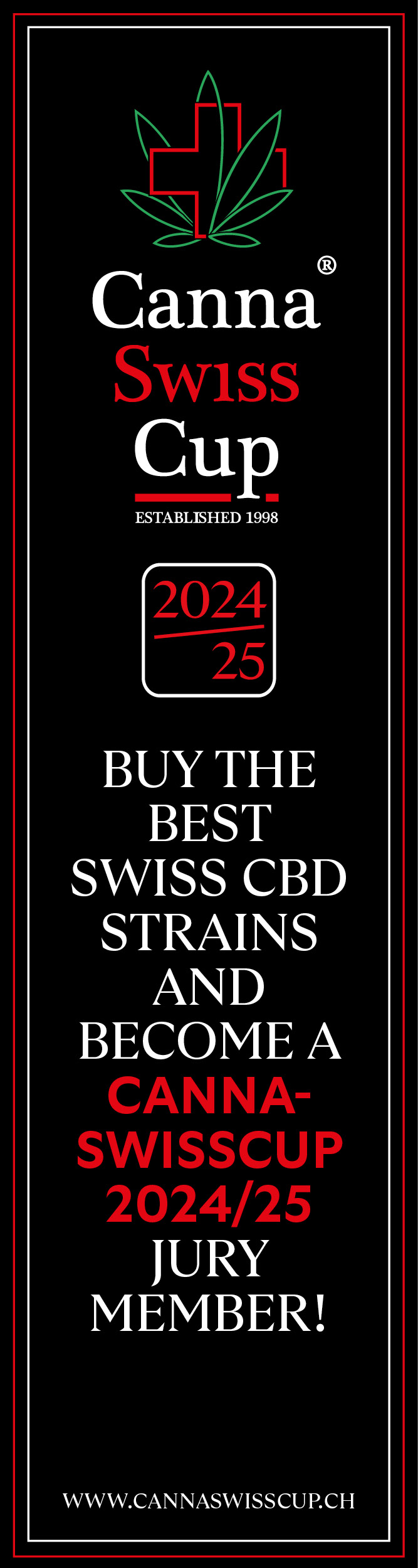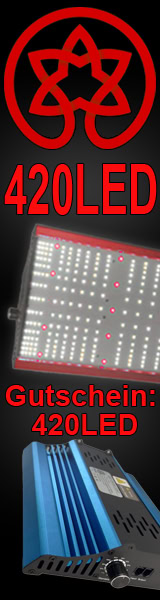Seit 2017 kann Cannabis als Medizin unter den richtigen Umständen an Patienten verschrieben werden, doch immer noch sind die bürokratischen Hürden zu hoch. Diese Meinung vertreten nicht nur die bedürftigen Patienten, sondern auch viele der behandelnden und zur Therapie ratenden Mediziner.
Johannes Horlemann, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS), äußerte sich jüngst auf Ärzteblatt.de dahin gehend, dass chronisch kranke Patienten mindestens fünf Wochen darauf zu warten hätten, bis Krankenkassen über den Antrag, Cannabisarznei unter Kostenübernahme einsetzen zu dürfen, entschieden hätten. Gäbe es dazu ein Widerspruchsverfahren, könnten bis zur Entscheidungsfindung Monate vergehen, was der Präsident der DGS als einen inhumanen Umgang mit schwer kranken Menschen auf einer am 31.08. stattfindenden Online-Pressekonferenz bezeichnete.
Auch der DGS-Vizepräsident kritisiert
Der Vizepräsident der DGS, Norbert Schürmann, wies auch darauf hin, dass die langen Wartezeiten zudem von der jeweiligen Krankenkasse, dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen sowie der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter abhängig seien. Es wäre in diesem Zusammenhang auch sehr problematisch, dass die Krankenkassen keine Unterschiede bezüglich der Schwere der Erkrankungen der jeweiligen antragstellenden Patienten zu machen hätten.
Während laut des kürzlich veröffentlichten Abschlussberichtes der Begleiterhebung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) betreffend Cannabis in der Medizin circa zwei Drittel der gestellten Anträge von den Kassen übernommen werden würden, stünden ungefähr 24.000 Patienten ohne Kostenübernahme allein da. Die häufigsten Gründe für die Verschreibung von Cannabisarzneimitteln seien hierbei in der chronischen Schmerztherapie zu finden, wobei insbesondere neuropathische Schmerzen einen Großteil ausmachen sollen. Doch wie Schürmann erklärte, gäbe es auch bei palliativen Erkrankungen, die Übelkeit und Erbrechen hervorriefen, oder Appetitlosigkeit und Tumorkachexie sehr gute Ergebnisse zu vermelden.
Weniger Opioide und weitere Vorteile
Der Einsatz von Cannabis als zusätzliche Therapie, wenn andere Behandlungen bereits – ohne Wirkung zu zeigen – ausgeschöpft wurden, könne als gangbarer Weg verstanden werden. Auch, da das natürliche Arzneimittel den Konsum von verschreibungspflichtigen Opioiden signifikant reduzieren würde. Sollten Letztere schwer verträglich für den Patienten sein, verbessere Cannabis somit dessen Lebensqualität spürbar.
Laut Schürmann habe man dazu nun feststellen können, dass Cannabisblüten in der Therapie schwieriger zu steuern wären als oral einnehmbare Cannabinoide und dass sie ein höheres Abhängigkeitspotenzial aufweisen würden. Ebenfalls wären Jugendliche unter 25 Jahren beim Einsatz von Blüten anfälliger für Psychosen. Die Halbwertzeit sei dazu bei den oral eingenommenen Cannabinoiden länger, was bei einem gleichbleibenden Wirkungsspiegel zu wesentlich weniger Nebenwirkungen und besonders weniger ZNS-Störungen führe. Die Schmerzunterdrückung könne jedoch konstant niedrig gehalten werden.
Bürokratische Hürden abbauen
Um die Verschreibung von Cannabis für medizinische Anwendungen zu vereinfachen und die kritisierten Hürden etwas zu verkleinern, hatte die DGS bereits im März mit der Krankenkasse AOK einen Vertrag für eine bessere Versorgung von Patienten mit Cannabinoiden geschlossen. Bei der AOK-Rheinland/Hamburg soll der Selektivvertrag dafür sorgen, dass der Einsatz im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein eine vereinfachte Verordnung von Cannabispräparaten ermöglicht. In Absprache mit dem Patienten läge die Therapieentscheidung somit nun ausschließlich bei den behandelnden Ärzten. Einzig eine 20-stündige Online-Fortbildung müsse dafür absolviert werden, welche eine anschließende Lernerfolgskontrolle beinhaltet.
Die beteiligten Vertragspartner hätten den Vertrag bereits unterzeichnet und nur die praktische Umsetzung stünde noch aus, berichtet der DGS-Präsident Horlemann. Dazu würde die DGS sich dafür einsetzen, das Wissen über die Einsatzmöglichkeiten von Cannabis in der Medizin durch mehr Fortbildungen zu vergrößern. Man müsse hierbei die Expertise über alle Fachbereiche verteilen, da bislang in erster Linie vor allem Neurologen und Schmerzmediziner Cannabinoide verschreiben würden. Hausärzte und Palliativmediziner gehörten nach Meinung Horlemanns mit an Bord geholt, damit sich dies ändere. Er merkte hierbei ebenfalls an, dass besonders junge Ärzte an den Einsatzmöglichkeiten von Cannabis interessiert wären.
Die Hürden für den gesundheitlich förderlichen Gebrauch müssen somit wohl nur ein wenig nach unten gesenkt werden, damit mehr Kranke von den zuträglichen Fähigkeiten des natürlichen Arzneimittels tatsächlich profitieren können.