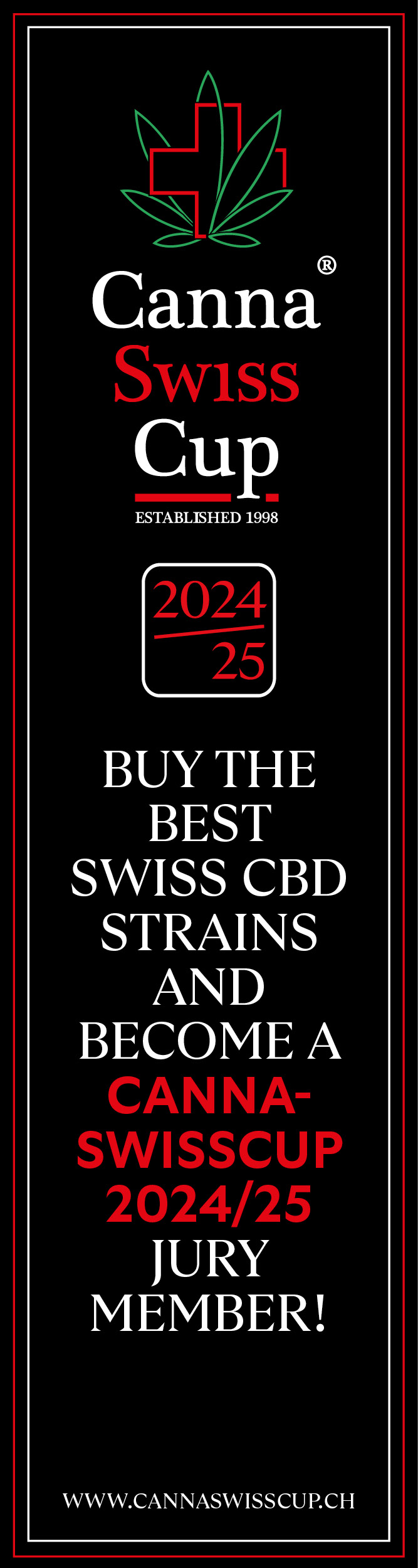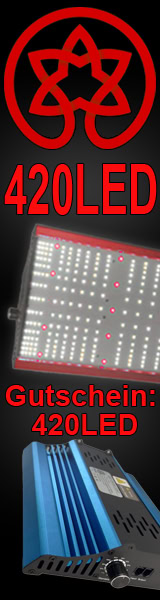Heute Morgen habe ich eine junge Frau interviewt, die unter einer der meist verbreiteten Krankheiten Deutschlands leidet. Eine Krankheit, die immer noch totgeschwiegen, tabuisiert und bagatellisiert wird. Die Depression. Im Fall von May (Name geändert) kamen noch einige Unwägbarkeiten hinzu, denn sie konsumiert Cannabis.
Im medizinischen Sinne, aber leider nicht mehr legal. Wie es ihr beim Versuch sich helfen zu lassen erging, wie sie generell mit ihrer kriminalisierten Lage umgeht, und wie sie sich zurück ins Leben kämpft, habe ich sie heute gefragt. Heute Morgen war ihre Welt noch in Ordnung. Zumindest bestand wieder Hoffnung, die ihr das Burn-out in den vergangenen Monaten genommen hatte.
Ihr Termin zur Aufnahme in die Klinik stand an. Tagesklinik – anthroposophisch – ganzheitlich – alternativ! Alles Worte, die sie bewogen hatten, diese Klinik zu wählen. „Ich bin ein bisschen speziell, sagt sie, aber wer ist das nicht! Ich habe ADHS und konsumiere seit über 15 Jahren Cannabis, um schlafen zu können. Es hilft mir sehr gut, und hat keine Nebenwirkungen – ein Segen, nachdem ich auf meiner verzweifelten Suche nach dem richtigen Medikament schon beinahe Schlaftabletten, opioid- und benzodiazepinabhängig war!“
All das sind starke Beruhigungsmittel, mit vielen Nebenwirkungen und hohem Abhängigkeitspotential. Für May ist klar, dass sie keins der Mittel mehr anrühren will, und sie war sich sicher, dass eine anthroposophische Klinik ihren Ansprüchen gerecht würde. 3 Monate hatte sie auf die Aufnahme gewartet. 3 Monate voller Angst, Panik, Depression und einem immer kleiner werdenden Freundeskreis. „Das war es mir wert. Ich wollte in eine Klinik!“
Einen Therapieplatz zu bekommen ist allerdings, hauptsächlich in Großstädten, ein ständig wachsendes Problem. Die Wartelisten sind voll, und zwar für fast jede Therapie. Selbst die Wartelisten für Diagnosen von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit Hyperaktivität), sowie ASS (Autismus Spektrumsstörung) sind in Berlin so voll, dass sie zeitweise sogar geschlossen werden. Auf eine Diagnose in einer Klinik wartet man schon mal zwei Jahre aufwärts, für einen Platz in einer Tagesklinik ca. 3 Monate, und für eine stationäre Aufnahme liegt man dazwischen. Auch auf eine ambulante Therapie wartet man in Deutschland im Schnitt 4 Monate, berichtete das Ärzteblatt zuletzt Ende 2018.
„Ich hatte es nach einem Monat Bürokratiewahnsinn und anschließenden 3 Monaten Wartezeit endlich geschafft“, berichtet sie später betreten, „all meine Hoffnung lag in diesem Aufenthalt. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst.“
Der Bus hält abrupt, der kühle Waldwind weht May die Haare aus dem Gesicht. Die Aufregung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Auch dass die Klinik im Wald war, hatte ihr gefallen. „Man hat doch Angst und ist befangen. Schließlich sind die Menschen, denen man dort all seine Probleme erzählen soll, völlig Fremde. Ich dachte, die Umgebung würde mir helfen, mich zu entspannen.“
Sie geht den langen Weg über das weitläufige Gelände in großen Schritten. Die Anspannung ist ihr deutlich anzumerken. Angekommen, öffnen sich zwei große Glastüren automatisch. An der Anmeldung hat erst mal niemand Zeit. Sie soll sich setzen und warten. Es herrscht geschäftiges Treiben. Offenbar ist Aufnahmetag.
„Die Wartezeit war wahnsinnig anstrengend“, sagt May hinterher, man denkt permanent darüber nach, was die Anderen wohl denken. Und was nun auf einen zukommt, und ob man wirklich alles erzählen muss, und ob einem wirklich geholfen ist…“ Sie seufzt tief. Sie ist alleine hier. Jemandem zu vertrauen, fällt ihr momentan schwer. „Vielleicht lerne ich das ja wieder. Hier muss ich auch Vertrauen haben.“
Endlich wird sie aufgerufen. Sie verschwindet mit einer forsch wirkenden, älteren Dame in einem Zimmer. Dort angekommen, wird ihr nun das Konzept der Klinik, und der Schematherapie erklärt. Sie schnauft: „Das sah alles sehr kompliziert aus und hat mich ein bisschen überfordert. Ich bekam einen Stapel Zettel in die Hand gedrückt, mit einer Art Stundenplan. Ich wollte es mir in der Mittagspause genauer ansehen, in Ruhe.“ Nach einer guten halben Stunde kam sie mit den Zetteln aus dem kleinen Büro.
Sie hatte auch erfahren, dass es jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr losging, was bedeutete, dass sie bei ihrem Weg jeden Morgen um 5.30 Uhr aufstehen musste. „Ich hab mir deshalb ein wenig Sorgen gemacht. Seit es mir so schlecht geht, ist es ohnehin ein Problem aus dem Bett zu kommen. Allerdings wird man auch nicht von alleine gesund. Wenn mir diese Therapie hilft, dann muss ich mich auch dort hinbewegen!“
Als Nächstes stand das Erstgespräch beim Psychologen an. Eine Stunde sollte es dauern, aber vorher war Mittagspause. May war das ganz recht, sie musste erst mal ihre Gedanken und vor allem die vielen Zettel ordnen. „Ich wollte das verstanden haben, bevor ich mit der Psychologin rede“, sagt sie. Dass sie für dieses Gespräch den Kopf freihaben wollte, hat einen Grund. May hat ADHS und konsumiert schon seit ihrem jungen Erwachsenenalter Cannabis, um zu schlafen. Die mit ADHS einhergehende geistige und motorische Unruhe kann sehr belastend sein, die Leistungseinbrüche aufgrund von Schlaflosigkeit ebenfalls, und dass man mit einer gestörten Aufmerksamkeit von einem ausgeruhten Gehirn noch mehr profitiert als ein neurotypischer Mensch, liegt auf der Hand.
Als am 9. März 2017 das Gesetz für medizinisches Cannabis in Deutschland im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, verdiente May noch gutes Geld, und stand mitten im Leben. Sie hatte damals Cannabis über ein Privatrezept erhalten, dass sie sich nach ihrem Zusammenbruch natürlich nicht mehr leisten konnte. Sie war gekündigt worden, und hatte danach ihre Wohnung verloren. Nun wohnte sie am Stadtrand, weitab von dem pulsierenden Leben, das sie vor vielen Jahren nach Berlin gezogen hatte, und war seelisch nicht mehr belastbar. So war die Aussicht auf eine Arbeit, vor allem auf eine, die ihr gefiel, sehr gering.
Die Krankenkassen zahlen in Deutschland kein medizinisches Cannabis für ADHS. Es gäbe keine Studien über die Wirksamkeit, ist das allgemeine Argument. Die letzte abgewiesene Klage vom Dezember 2018, stuft ADHS als eine Erkrankung ein, die nicht schwer genug ist, um Cannabis zu verschreiben, Ritalin allerdings ist offenbar unproblematisch [2]. Des Weiteren zeigen amerikanische Studien, dass die Symptome von ADHS bei Erwachsenen durch Cannabis deutlich weniger werden [3].
Zusätzlich stuft das Gericht Cannabis als ein Medikament ein, das schwerwiegende Symptome lindern und nicht einfach zur Alltagsbewältigung eingesetzt werden soll.
Dem aufmerksamen Leser werden sich zwei Fragen stellen: Erstens, was gibt es Wichtigeres als die Bewältigung des Alltags, um ein erfülltes Leben zu führen, bzw. ist die nicht Bewältigung des Alltags nicht ein schwerwiegendes Symptom? Zweitens, warum eigentlich nicht? Warum soll Cannabis Menschen nicht helfen, ihren Alltag zu bewältigen, wenn es denn offenbar funktioniert? Diese beiden Fragen kann jeder nun gerne für sich beantworten, und ich kehre zu May zurück.
May war von inzwischen an wieder auf den Schwarzmarkt angewiesen, obwohl sich zur Schlaflosigkeit noch Angst, und Depression gesellt hatten. Beides zusätzliche Indikationen für Cannabis. Allerdings sieht die Fachpresse das im Moment anders, und so sind Menschen wie May zwangsläufig kriminell [4]. In den Anmeldeunterlagen, die sie der Klinik vor 3 Monaten zuschickte, hatte sie das Cannabis erst mal nicht erwähnt. Nicht weil es ihr peinlich war oder sie kein ehrlicher Mensch sei – sie hatte schlichtweg Angst, ihr würde nicht geholfen, weil man sie für drogenabhängig hielte. Jetzt war sie sicher, dass das Thema im Erstgespräch noch mal auf den Tisch käme, und sie war sich nicht sicher, wie sie dieses Mal reagieren sollte.
„Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, und eigentlich froh, dass ich Cannabis habe. Ich habe vorher vieles ausprobiert, mit den unterschiedlichsten Folgen. Von einer bunten Palette an Nebenwirkungen bis fast zur Abhängigkeit hin war alles dabei. Und zwar seit meiner Jugend. Sie entschloss sich, zu versuchen, ihre Situation zu erklären. Wie sollte eine Psychotherapie nutzen, bei der sie nicht ehrlich war? Sie hatte sich vorher lange über die Klinik belesen. Diese Klinik behandelte auf anderen Stationen mit vielen alternativen Therapien, von Mistel bis Cannabis. Ihre Chancen standen also gut. Ihre Argumente waren plausibel und überzeugend. Die Psychologin kam, und bat sie zum Gespräch….
Eine bieder gekleidete Frau im dunklen Kostüm betritt den Pausenraum der Klinik. May, welche noch immer mit ihren Zetteln beschäftigt war, und langsam zu verstehen schien, schreckte hoch. „Guten Tag, Frau Jankins“, sagte die Dame freundlich und professionell. „Guten Tag“, sagte May, und erhob sich nervös von ihrem Stuhl. Jetzt ging es um alles.
Jetzt würde sich entscheiden, ob man ihr zuhören, sie verstehen, ihr helfen würde.
Wieder öffnete sich nach einer knappen Stunde die Tür, sah May etwas zerstreut und dieses Mal deutlich entkräftet aus. „Ich habe es ihr erzählt“, sagt sie, „…. das mit dem Cannabis.“ „Ich glaube sie hat mich verstanden, aber sie will das noch mit jemandem klären.“ May schaut zu Boden, man möchte sie in den Arm nehmen, so verletzlich sieht sie aus. „Ich habe ihr auch von der Gewalt erzählt, und von meinem Ex-Freund. Und was mit meiner Wohnung und dem Job passiert ist… „, sie schluckte den Kloß im Hals wieder herunter, „… ich habe versucht nicht zu weinen. Ich wollte… Ich habe Angst, dass ich nicht bleiben darf!“
May wurde gefragt, warum sie ihren Konsum nicht im Antrag vermerkt hatte, man hätte sich darum kümmern können, was immer das bedeutete. Sie gab dieselbe Antwort, die sie mir gegeben hatte. Die Minuten verstrichen und May war etwas hilflos. Irgendwo in diesen Räumen entschied gerade irgendjemand über ihre Zukunft.
Sie wälzte Gedanken: Hätte sie es doch im Antrag vermerken sollen? War sie nun unglaubwürdig, gar eine Lügnerin? Und mit wem sprach eigentlich die Psychologin… was sagte sie, und wer hatte überhaupt über eine solche Sache zu entscheiden? Sie wurde jäh aus ihren Gedanken gerissen, als die nette Dame, die sie aufgenommen hatte, ihr freundlich intonierend entgegenkam. „Na, haben wir uns denn entschieden?“ Sie meinte den Bogen mit den Stundenplänen. „Ich wollte nur sichergehen, dass sie alles verstanden und ihre Kurse zusammengestellt haben“, sagt sie und winkt May zu sich heran.
„Wir können dann jetzt nämlich ihren Therapieplan für die nächsten Wochen festmachen. Ich schreibe mir alle Kurse auf, die sie gewählt haben. Dann merken wir, wenn sie fehlen!“ sagt sie und lacht. May schien deutlich erleichtert. Wenn diese nette Frau ihre Kurse aufnahm, konnte das nur bedeuten, dass sie es geschafft hatte.
Inzwischen war sie seit Stunden auf den Beinen nach einer schlaflosen Nacht und einem Morgen, der so voller Aufregung war, dass sie ihr Frühstück nicht runterbekam. Sie wollte einfach nur noch, dass alles gut wird, und in ihr Bett. Sie hatte anstrengende Gespräche geführt, sich mit anderen Patienten ausgetauscht, Fragen beantwortet, Kurse ausgesucht, intime Dinge preisgegeben… Sie wollte, dass dieser Tag endet, denn morgen sollte der erste Tag ihres neuen Lebens werden – ihr erster Therapietag.
Müde und dankbar stand May auf dem Flur und unterhielt sich mit dem Therapeuten des ersten Kurses, den sie morgen besuchen würde, als plötzlich von hinten die Psychologin heranrauschte und ihr den Stapel Zettel aus der Hand schnappte, auf denen ihre Kurse vermerkt waren. „Ich habe das besprochen…. ihre Aufnahme ist hier so nicht möglich.“ May war wie vom Blitz getroffen und den Tränen nahe. Selbst ihr ADHS war ihr im Halse stecken geblieben. Sie bekam kein Wort heraus. Auch der Therapeut, der ihr gegenüberstand, schaute erschrocken drein. „Ich habe mit meinem Vorgesetzten gesprochen. Wir können hier niemanden aufnehmen, der Drogen nimmt!“ In Mays Kopf dröhnte es.
Hatte sie dieser Frau nicht vor einer Stunde alles erklärt, ihre Ängste kommuniziert, von ihren beinahe Abhängigkeiten berichtet und sie um Hilfe gebeten? Hatte sie ihr nicht gerade noch erzählt, wie wichtig das Cannabis ist, um ihre Ängste in den Griff zu bekommen und zu schlafen? Sie fühlte sich verraten! „Aber ich nehme es, damit ich nichts Chemisches nehmen muss“, sagte sie verzweifelt, als sie ihre Stimme wiedergefunden hatte. „Das ist für mich keine Droge, ich mache das nicht zum Spaß!“
„Sie können so nicht an der Therapie teilnehmen. Sie müssen eine Entgiftung machen“, entgegnete die Psychologin harsch und unversöhnlich. „Vielleicht sind ihre Probleme substanzabhängig.“ Da platzte May der Kragen: „Ich habe ihnen doch erklärt, dass ich es anstelle von Schlaftabletten und Benzodiazepinen nehme. Ich will nicht abhängig werden, nur schlafen!“, sagte sie bestimmt und unüberhörbar. Es war ihr egal, was die Leute von ihr dachten. Eine Drogenabhängige war sie in den Augen der Psychologin ja scheinbar ohnehin schon. Nun wollte sie vermeiden, dass die anderen Patienten dies auch dachten, deshalb rechtfertigte sie sich laut.
„Sie sagten vorhin, dass wir das schon irgendwie hinbekommen hätten, hätte ich nur gleich etwas gesagt… wie meinten sie das?“, fragte May und hoffte inständig auf eine rettende Antwort. „Wir stellen sie ein“, sagte die Psychologin trocken. „Wie meinen sie das?“, fragte May vorsichtig. „Sie bekommen Schlaftabletten mit nach Hause und gegen die Angst Benzodiazepin…, dann schaffen sie das schon ohne Cannabis. May war schwindelig. Sie konnte einfach nicht fassen, was ihr da gerade von einer Frau vorgeschlagen wurde, der sie ihren gesamten Leidensweg erzählt hatte, von der sie sich Hilfe und Verständnis erhofft hatte, die um ihre Suchtproblematik wusste. Sie holte tief Luft und schluckte ihre Worte herunter. Sie hatten hier kein Gewicht. Offenbar wollte man nicht verstehen.
Jahrelang hatte sie gekämpft, um nicht abhängig zu werden und dann das Cannabis gefunden, von dem ihr nun eine Psychologin abriet, um ihr dieselben suchterzeugenden Stoffe ohne Vorbehalt wieder zu verschreiben. Das einzige Wort, das ihr entfuhr, war “NEIN!“ Es konnte nicht ihr Weg sein, wieder mit alten Teufeln zu tanzen, um der aktuellen Hölle zu entkommen! Vielleicht gab es ambulant Möglichkeiten… ihr Kopf raste.
„Wenn sie nicht bleiben wollen, dann müssen wir sie bitten, unser Haus zu verlassen. Hier haben nur Patienten und Ärzte Zutritt“, sagte die Dame hölzern. Offenbar war es nicht in ihrem Interesse, dass May sich noch von anderen Patienten verabschiedete oder sich gar austauschte. May hätte ihr gerne die Meinung gesagt, aber dazu fehlte ihr die Kraft. Sie wusste nicht, wie es nun weitergehen sollte, aber erst mal musste sie hier raus. Mit ähnlich großen Schritten wie auf dem Hinweg kämpfte sie sich an den Glastüren vorbei ins Freie. Sie wollte jetzt nicht weinen, sie wollte sauer sein. Sie fühlte sich so hilflos und im Stich gelassen… so stand sie dort allein mitten im Wald. Man hatte niemanden geschickt, der sie in diesem emotionalen Chaos auffing. Niemanden, der sie sicher zur Bahn brachte. Sie stand ganz allein in einem Wald. Depressiv.
Natürlich wird Mays Geschichte hier nicht enden. Der Kampf um ihr Recht, Hilfe zu bekommen, gibt ihr Kraft. Inzwischen weiß sie, dass es viele Menschen gibt, denen es ähnlich erging. Sie ist nicht alleine mit ihrem Problem und findet auf ihrem Weg noch zu vertrauenswürdigen Ärzten und hilfsbereiten Patienten. Sie geht einen vollkommen neuen Weg, und zwar den in die medizinische Cannabis Legalität. All dies, und noch mehr, wird im zweiten Teil „Wenn Therapien helfen“ zu lesen sein.