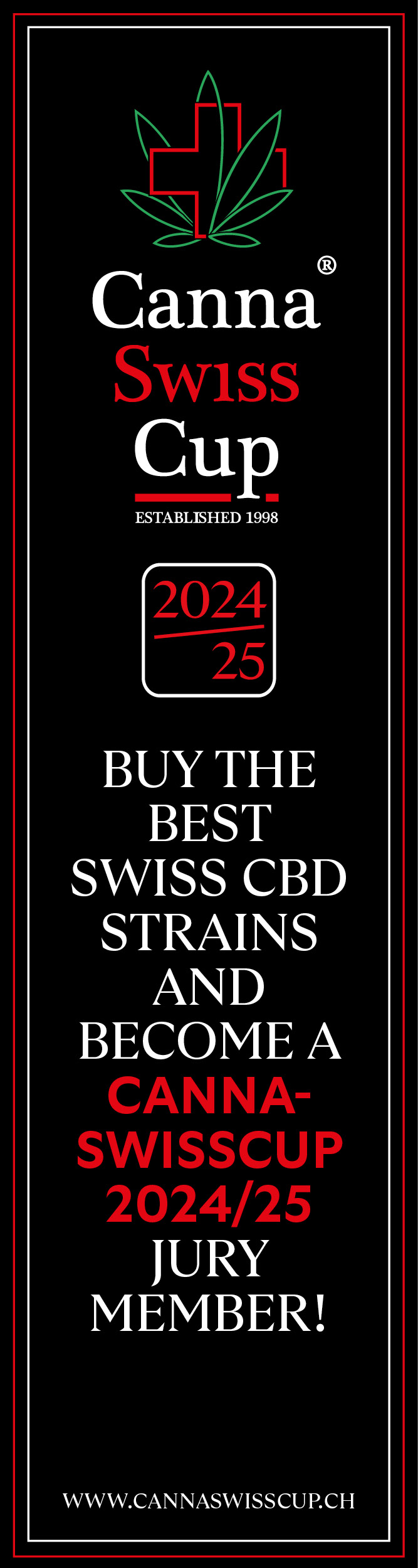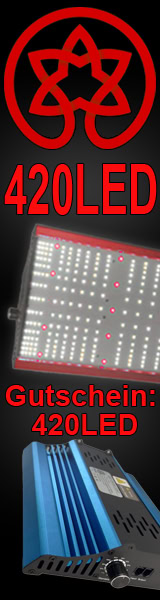Als ich Silvio zum ersten mal nach sechs Monaten wieder treffe, wirkt er ein wenig gehetzt: „Ich habe gerade meine Medizin aus der Laube geholt, muss jetzt noch Spätschicht machen und dann die Dose im Gartenhäuschen bunkern, bevor ich heute Abend wieder einfahre“, begrüßt mich der 43-jährige Berliner. Mit Einfahren meint Silvio die allabendliche Rückkehr ins traute Heim Haftanstalt.
Kann man im Knast legal kiffen?
Silvio ist seit Anfang November 2020 Häftling der JVA Berlin-Hakenfelde, weil er vor ein paar Jahren zusammen mit zwei Freunden insgesamt acht Kilogramm Cannabis angebaut hatte. Der gebürtige Berliner ist aber auch Cannabispatient, dessen Krankenkasse Monat für Monat die Kosten für 90 Gramm Medizinal-Hanfblüten übernimmt. Das war früher, als Silvio noch illegal Gras angebaut hat, nicht der Fall, aber das steht auf einem ganz andren Blatt. Heute kämpft der 43-Jährige um die Fortsetzung seiner Therapie hinter Gittern – und hat nach einigen Rückschlägen endlich auch einen kleinen Erfolg zu vermelden.
Silvio besitzt seit kurzer Zeit den Status eines Freigängers und darf außerhalb der Gefängnismauern seine Therapie fortsetzen, wenn auch unter schwer nachvollziehbaren Auflagen. So muss er vor und nach seiner Arbeit als Pfleger einen einstündigen Umweg in Kauf nehmen, um seine Medizin in einer Gartenlaube abzuholen und später dort wieder zu bunkern. Denn Medikamente dürfen grundsätzlich nicht in den Knast eingeführt werden, sondern werden von den dort beschäftigten Medizinerinnen verordnet. Weil seine Abwesenheit aufgrund des Umwegs zum Gras-Bunker länger als eigentlich gestattet dauert, muss dieser extra beantragt und genehmigt werden. Immerhin gewährt der Staat fürs Inhalieren und Wegschließen des Weeds täglich zwei Extra-Stunden.
Medizinisches Cannabis? Nur für Freigänger!
Bis er die Therapie als Freigänger fortsetzen konnte, musste Silvio eben jene Sonderbehandlung erdulden, die Cannabispatienten auf unbekanntem Terrain häufig widerfährt. Strafgefangene dürfen grundsätzlich keine vom Haus- oder Facharzt verschriebenen Medikamente in eine Haftanstalt mitnehmen. Doch sie dürfen in der Regel eine einmal angefangene Therapie auch hinter Gittern fortsetzen, egal ob diese auf der Gabe von Betäubungsmitteln oder anderen Medikamenten basiert – es sei denn, es handelt sich um Cannabis. Hier versuchen die JVAs bundesweit vehement, medizinische Cannabisblüten vor den Gefängnistoren den juristischen Garaus zu machen.
Auch die Umstellung von Blüten auf Extrakte wird Strafgefangenen in der Regel verwehrt. Befürchtungen, der medizinische Cannabiskonsum eines Patienten könne Begehrlichkeiten und Missmut bei den Mitgefangenen erzeugen, sind durchaus begründet. Aber eine echte rechtliche Grundlage, Menschen wie Silvio die verordnete Medizin hinter Gittern vorzuenthalten, gibt es eben nicht. So wäre Verordnung von Extrakten eine Alternative, die geruchsfrei und unbemerkt von den Mithäftlingen appliziert werden kann. Doch zu Haftantritt verweigerte die JVA-Ärztin sowohl die Weiterverordnung von Cannabisblüten als auch eine Umstellung des Patienten auf Cannabis-Extrakte. Man bot Silvio statt dessen Diazepam an.
„Ich konnte natürlich nach dem plötzlichen Absetzen der Cannabistherapie und dem ganzen Stress im neuen Umfeld kaum noch pennen. Wenn ich mal eingepennt bin, hatte ich üble Albträume und bis nass geschwitzt aufgewacht. Als ich das der Ärztin erzählt habe, hat die mir ratzfatz Diazepam verschrieben. Das habe ich einmal genommen und war wirklich betäubt. Aber ich weiß, wie schnell das Zeug abhängig macht und habe es nicht mehr genommen – da habe ich lieber nachts weiter stundenlang wach gelegen und gegrübelt“.
Unklare Haltung der Justizverwaltung
Zudem spielt das Kostenargument wohl eine nicht unerhebliche Rolle, müsste doch die Justizkasse die Kosten für Silvios Therapie übernehmen.
Die Justizverwaltung des Landes Berlin teilte im November 2020 auf Anfrage mit, das Einbringungsverbot gelte auch medizinisches Cannabis, egal ob als Blüte, Extrakt oder Fertigarzneimittel. Und weiter: „Medizinisches Cannabis wird im Berliner Justizvollzug grundsätzlich nicht verschrieben, bei Bedarf müssen ggf. andere Therapien gefunden werden“. Doch Cannabispatienten wie Silvio mussten schon bei ihrer Krankenkasse detailliert belegen, dass andere Therapien nicht anschlagen und Cannabis die Ultima Ratio ist, damit die Kasse die Kosten übernimmt. Hiermit konfrontiert heißt es dann auf erneute Nachfrage aus der Berliner Justizverwaltung:
„Der Hinweis auf die grundsätzliche Verordnungspraxis impliziert bereits, dass nach sorgfältiger medizinischer Indikationsprüfung eben auch Verordnungen von Cannabinoid-Präparaten erfolgen können bzw. erfolgt sind.“ Was nun? Grundsätzlich nicht oder nach sorgfältiger Prüfung?
Gericht lehnt Therapie hinter Gittern ab
Bei Freigängern sieht die Sache anders aus. Hierzu antwortet die Pressestelle: „Weist ein Freigänger bei Rückkehr in die JVA eine positive UK (Anm. Urinkontrolle) auf, wird dies dann von der Anstalt toleriert, sofern der Freigänger die medizinische Anordnung nachweisen kann.“
Doch zu Haftantritt war Silvio noch kein Freigänger. Nachdem die Anstaltsärztin ihm trotz eindeutiger Aktenlage die Fortsetzung der Therapie verweigert hatte, setzt sich Silvio mit seiner Anwältin in Verbindung und klagt per Eilverfahren. Doch auch das Landgericht Berlin befindet, Silvio stehe im Knast keine Cannabinoid-Therapie zu, weil die Kasse bei der Genehmigung einen Fehler gemacht habe. Die Kosten für seine Therapie würden lediglich übernommen, weil die Kasse 2018 Fristen verpasst habe, nicht aus medizinischer Notwendigkeit. Das mit dem Fristversäumnis ist zwar richtig, aber wie kann dieser formale Fehler der Kasse alle medizinischen Gutachten, die Silvio vorgelegt hatte, zunichtemachen?
Denkt man das zu Ende, könnten Kassen bei eindeutigen Diagnosen, bei denen eine Kostenübernahme nicht zu verhindern ist, mit vorsätzlichen Fristversäumnissen dafür sorgen, dass Patienten vor Gericht die medizinische Notwendigkeit schwer nachweisen können, weil ja die versäumte Frist Grund der Kostenübernahme war – nicht die Diagnose.
Nach diesem Urteil hatte Silvio zwei Möglichkeiten:
- Eine Anfechtung des Urteils hätte zwar in der nächsten Instanz durchaus Aussichten auf Erfolg gehabt. Doch Silvio wäre bis zur endgültigen Entscheidung monatelang ohne Aussicht auf Freigang, Arbeit sowie ohne Medizin in seiner Zelle geblieben.
- Akzeptiert er das Urteil, ist er binnen weniger Wochen Freigänger und kann seine Therapie draußen fortsetzen.
Silvio entscheidet sich also im Januar 2021, das Urteil anzunehmen. Wenige Wochen später darf er seine Arbeit wieder aufnehmen und sich beim Facharzt Cannabis verschreiben lassen. Weil er es nicht im Knast aufbewahren darf, bekommt er täglich sogar zwei Stunden Zeit, seine Medizin einzunehmen und wegzuschließen, bevor er selbst über Nacht weggeschlossen wird.
„Mir geht es so viel besser als vorher, aber optimal ist anders“, erzählt mir der Ex-Grower.
„Eigentlich sollte ich meine Dosis ja verteilt über 16 Stunden einnehmen. Jetzt habe ich gar keine Möglichkeit, mir das so einzuteilen, wie es auf der Verordnung steht. Ich muss immer die doppelte Dosis inhalieren, damit ich den Rest vom engen Zeitplan schaffe. Also morgens zwei, dann arbeiten und abends schnell drei Dinger. Deshalb bin ich immer total breit, wenn ich im Knast ankomme. Mir wäre es am liebsten, wenn ich von der Anstalt einfach Tropfen bekäme. Denn solange ich noch nicht außerhalb der Gefängnismauern schlafen darf, muss ich die Therapie immer unterbrechen, wenn ich nicht arbeiten muss. Das ist zwar schon viel besser als vorher jetzt, aber optimal ist das sicher nicht.“
Angst vorm Tabubruch oder Kostenfrage?
Angesichts der rechtlich fragwürdigen Sonderbehandlung von inhaftierten Cannabispatienten wie Silvio stellt sich die Frage nach dem Warum? Geht es darum, Häftlingen medizinisches Gras grundsätzlich zu vorzuenthalten, um die Angst vor der Reaktion Mitgefangener oder einfach nur ums Geld?
Justiz und Anstaltsleitungen befürchten sicher zurecht, dass legal kiffende Häftlinge Unverständnis und Unzufriedenheit bei den Mitinhaftieren auslösen würden. Also tut man schon um des lieben Friedens willen alles ein solches Szenario zu verhindern. Das ist durchaus nachvollziehbar. Was aber spricht gegen die Umstellung auf Extrakte? Eine solche wäre komplett geruchsneutral und gegenüber Dritten einfach zu erklären. Allerdings müsste die Justizkasse für die Kosten aufkommen. Das wäre selbst bei einer sehr niedrigen Verordnung von 1 Gramm Blüten (20 % THC)/Tag bei dem stärksten zur Verfügung stehenden Extrakt monatliche Therapiekosten von 3000 Euro. Bei Blüten belaufen sich die Therapiekosten bei der angeführten Menge je nach Sorte auf 600-700 Euro.
Die Justiz hat also die Wahl: Bezahlt sie die erschwingliche Therapie mit Cannabisblüten, darf im Knast gekifft werden – mit allen vorher erwähnten Konsequenzen. Übernimmt sie die Therapie mit Extrakten, kommen schnell Kosten zwischen 3000 und 10000/ Monat pro Patient auf sie zu.
Lehnt sie die Therapie ab, muss der Häftling klagen – und währenddessen ohne Medikament auf Hafterleichterungen wie zum Beispiel Freigang verzichten. Hier lohnt es sich aus Sicht der Justiz durchaus, aus finanziellen Gründen auf Zeit zu spielen.
Hinzu kommt, dass Freigänger wieder über die Krankenkasse versichert sind, bei der sie vor Haftantritt waren. Das heißt, die Kosten für deren Cannabis-Therapie müssen, anders als bei einer Cannabis-Verordnung im Knast, nicht mehr von der Haftanstalt getragen werden. Natürlich darf das kein offizieller Ablehnungsgrund für eine Therapie hinter Gittern sein. Die zuvor erwähnten Therapiekosten für Cannabis-Extrakte legen aber nahe, dass das Kostenargument hier eine erhebliche Rolle spielen könnte, medizinisches Cannabis nur Freigängern zu gewähren.
Die brisante Mischung dieser Faktoren wird die Verordnung von Cannabis hinter Schloss und Riegel so lange unmöglich machen, bis der Gesetzgeber aktiv einschreitet und dafür sorgt, dass auch inhaftierte Cannabispatienten eine Therapie fortsetzen dürfen, für die es gemäß Kasse und MDK keine Alternative gibt.